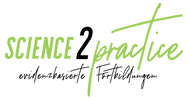Pascale GränicherZur Bearbeitung hier klicken «Beim letzten Patienten hat das auch geholfen, also wende ich die gleiche Intervention beim Nächsten auch wieder an.»
Das könnte die Rohfassung einer Hypothesenformulierung für eine spannende Studie sein. In der Regel wird aber weder ein validierter Befund noch eine standardisierte Behandlung folgen, um die Wirksamkeit dieser hilfreichen Therapie zu überprüfen. Die eigene Erfahrung zählt schliesslich am meisten. Und da sind wir Physio- und Ergotherapeuten oder auch Osteopathen und Ärzte auch ganz objektiv. Denn schliesslich wissen wir was wir tun und blicken auf eine langjährige Erfolgsstory mit zufriedenen Patienten zurück. Somit muss es ja nützen was wir tun. Wissen was wir wissen Wäre es aber nicht toll, wenn wir nicht nur das Gefühl hätten, dass das was wir tun das Problem mit der bestmöglichen Wahrscheinlichkeit bei der Wurzel packt und uns nicht einzig auf unsere Erinnerungswerte verlassen müssten? Unsere Erfahrung als medizin-therapeutische Spezialisten zählt natürlich zu den Daten, anhand derer die individuell zielführendste Intervention herausgeschält werden kann. Aber eben nicht nur, denn unser Gedächtnis ist kein Archiv unverfälschter Fakten – leider. Erinnerungen sind veränderbar Wie bereits in den 70er Jahren erforscht wurde, sind unsere Erinnerungen plastisch, also veränderbar. Somit kann durch externe Einflüsse oder durch eigene Fantasie an unseren Erinnerungen geschraubt werden (Loftus et al., 1978). Wie veränderbar, zeiget der Versuch von Loftus & Pickrell (1995), wo Probanden davon überzeugt werden konnten, dass sie als Kind in einem Einkaufszentrum verloren gingen – obwohl nie etwas Vergleichbares geschehen ist. Wie fehlbar unsere Erinnerungen sein können, zeigen auch die vielen Fälle von unrechtmässigen Verurteilungen von Unschuldigen aufgrund von falschen Zeugenaussagen. Durch das Innocence Project (2017) konnten seit 1989 durch die DNA-Analyse in 353 Fällen unschuldig Verurteilte freigesprochen werden. 70% dieser Urteile wurden aufgrund von Zeugenaussagen gefällt. Und mit «falsch» ist nicht absichtlich fehlerhaft dargestellt, sondern verfälscht durch zeitliche Verzerrung oder suggestive Befragungstechniken der Untersuchenden gemeint (Bruck & Ceci, 1995; Ceci & Bruck, 1993). Wenn wir also überzeugt sind, dass etwas in einer Weise geschehen ist, dann können sich unsere Erinnerungen tatsächlich verändern und der neuen Geschichte anpassen. Das heisst, wir blenden möglicherweise Fälle aus, bei denen unsere Lieblingstechnik oder die favorisierte Dehnungsübung nichts geholfen oder sogar mehr Beschwerden verursacht hat. Das verdrängen wir unbewusst… natürlich. Können wir das nicht verhindern? Da werden wir ja von unserem Hirn total fremdgesteuert! Erinnern wollen Einen Sinn hat das Unterdrücken von unangenehmen Erinnerungen aber schon: Wie Waldhauser und Kollegen (2018) bei Personen, die an posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) litten untersucht haben, erleben diese die auslösenden emotionale Situationen gedanklich immer und immer wieder. Probanden, die vergleichbar traumatische Ereignisse erlebten, aber nicht an einer PTBS litten, zeigten in der Magnetenzephalographie (MEG) geringer ausgeprägte sensorische Gedächtnisspuren als die PTBS-Gruppe. Das heisst, sie konnten die emotionalen Assoziationen besser unterdrücken. Es gilt weiter zu untersuchen, ob nun die PTBS die Erinnerungssteuerung hemmt oder die Kontrollgruppe eine bessere Coping-Strategie aufwies. Aber unser Gehirn scheint eine eigene Zensurstube zu unterhalten, um die Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen zu beschleunigen. Ob eine nicht anschlagende Technik für den Therapeuten aber als Trauma interpretiert werden sollte ist natürlich fraglich. Ein reflektierter und selbstkritischer Profi kann einen Fehlversuch mit ausgeklügelter, individuell auf den Klienten angepasster Trainingsbatterie mit Athlet Marko ebenso in seine Datenerhebung integrieren wie eine himmelhoch-jauchzendes Erfolgserlebnis nach einer simplen Patient Education bei Frau Meier. Überzeugte Augenzeugen Wie können wir als Augenzeugen unserer eigenen Intervention nun einen zuverlässigen Datensatz an Therapieerinnerungen erstellen? Grundsätzlich nicht ganz so schwierig: Wie Untersuchungen mit Zeugenaussagen gezeigt haben, sind unsere Erinnerungen je näher am Ereignis desto zuverlässiger (Wixted et al., 2018). Das heisst, eine Verlaufsdokumentation direkt während oder nach der Behandlung, ermöglicht eine reliable Aussage. Ein Blick in die Notizen vor der nächsten Therapiesitzung ist dann natürlich ebenfalls gefordert. Hinter die Ohren schreiben Der Einsatz von sauber durchgeführten, standardisierten Verlaufskontrollen erhöht die Aussagekraft unserer Erinnerungen. Auch hier dürfen sich Therapeuten und Ärzte am ganzen Buffet der Assessmentmöglichkeiten Bedienen: Von Fragebogen über Leistungstests bis hin zu Labormessungen bietet uns die Befundkiste alles was das Herz begehrt. Die sorgfältige Auswahl und Prüfung der Qualität des jeweiligen Werkzeugs sollte dabei selbstverständlich sein. Als Detektive des menschlichen Körpers können wir uns nicht ausschliesslich auf Indizien und den Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft verlassen – wir brauchen stichhaltige Beweise und wasserdichte Alibis bevor wir ein Urteil fällen. Und auch unsere Goldstandards sollten regelmässig hinterfragt werden -wie auch das Federal Bureau of Investigation (FBI) regelmässig seine Standards für die DNA-Analyse, ein valides und reliables Instrument in der Kriminalistik, überprüft (FBI, 2001; National Research Council, 2009). Da wir in der Praxis in der Regel nicht unter Laborbedingungen hantieren, ist neben einem strukturierten Clinical Reasoning, den standardisierten Assessments und wirksamen Interventionen auch eine Portion gesunder Menschenverstand und eine Ladung zwischenmenschlicher Qualitäten unabdingbar. Denn Frau Meier geht es tatsächlich schon etwas besser, wenn sie uns mag und uns vertraut (Hall et al., 2010). Das ist doch auch schon etwas! Mehr dazu…Auch Lars Avemarie beschäftigt sich regelmässig mit der Frage des bestmöglichen Behandlungsansatzes. Und nicht nur durch trockene Theorie, oder wie er sagt: „Nothing could be more humanistic than using evidence to find the best possible approaches to care„. Es gibt noch Tickets für den zweitägigen Kurs vom 30.-31. August in Zürich! Zum Thema „Neuroscientific Painmodulation“ – oder wie man optimal mit Schmerzpatienten arbeitet, wird im Technopark referiert und diskutiert. Wir freuen uns auf euch! Literatur Bruck, M. & Ceci, S.J. (1995) AMicus brief fort he case of State of New Jersy v. Michaels presented by Committee of Concerned Social Scientists. Psychology, Public Policy, and Law; 1: 272-322. Ceci, S.J. & Bruck, M. (1993). Suggestibility oft he child witness: A historical review and synthesis. Psychological Bulletin; 113: 403-439. Gerd T. Waldhauser, Martin J. Dahl, Martina Ruf-Leuschner, Veronika Müller-Bamouh, Maggie Schauer, Nikolai Axmacher, Thomas Elbert, Simon Hanslmayr: The neural dynamics of deficient memory control in heavily traumatized refugees, in: Scientific Reports, 2018, DOI: 10.1038/s41598- 018-31400-x Hall, A.M. et al. (2010). The Influence of the Therapist-Patient Relationship on Treatment Outcome in Physical Rehabilitation: A Systematic Review. Physical Therapy; 90 (8): 1099-1110. Innocence Project (2017). Eyewitness misidentification. Retrieved from: https://www.innocenceproject.org/eyewitness-identification-reform/ Loftus, E. F., Miller, D. G. & Burns, H. J. (1978). Semantic integration of verbal information into a visual memory. Journal of Experimental Psychology. Human Learning and Memory; 4: 19–31. Loftus, E. F. & Pickrell, J. E. (1995). The formation of false memories. Psychiatric Annals; 25: 720–725. National Research Council (2009). Strengthening forensic science in the United States: A path forward. Washington, DC: National Academy Press. Wixted, J.T., Mickes, L. & Fisher, R.P. (2018). Rethinking the Reliability of Eyewitness Memory. Perspectives on Psychological Science; 13 (3): 324-335. U.S. Federal Bureau of Investigation Department of Justice (2011). The FBI quality assurance standards audit for forensic DNA testing laboratories. Retrieved from: https://www.fbi.gov/file-repository/qas-audit-for-forensic-dna-testing-laboratories.pdf/view
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
AutorSchreiben Sie etwas über sich. Es muss nichts ausgefallenes sein, nur ein kleiner Überblick. Archiv
September 2023
Kategorien |
|
science2practice GmbH EVIDENZBASIERTE FORTBILDUNGEN Asylstrasse 32 CH-8708 Männedorf Email: [email protected] Telefon: +41 (0) 78 642 05 97 |
|