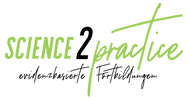|
von David Schmidt
Deutschlands Unfallversicherer kommen jährlich für Schäden in Höhe von ca. 60 Milliarden Euro auf. Warum sind deren Ursachen für unsere Therapie relevant und was können wir verbessern? Fehlende Konzentration, bedingt durch Selbstüberschätzung und falsche Risikobewertung, gilt als eine der zentralen Voraussetzungen für das Entstehen von Schäden und Verletzungen. Typisch menschliche Züge sorgen dafür, dass wir unsere Konzentration schleifen lassen. Wir überschätzen unsere eigenen Fähigkeiten und unterschätzen unsere Schwächen. Ein gefährlicher Mix, für den die Psychologie den Begriff der „Überlegenheitsillusion“ nutzt. Solche Verzerrungen verbessern zwar unser Wohlbefinden, machen uns optimistischer und generieren mehr Selbstvertrauen, schaffen aber leider auch die Voraussetzungen für unnötige Gefahren und Schäden. Entscheidend ist: Wer glaubt alles problemlos hinzubekommen, gefährdet schlussendlich sich und andere. Das gilt für sorglose Pilot:innen, betrunkene Autofahrer:innen und Opa auf der Leiter am Apfelbaum. Natürlich aber auch für unsere Arbeit mit Klient:innen. Beispiele aus der Wissenschaft gefällig?
Diese Liste liesse sich noch weiterführen. Es wird nur nicht besser. Zwei US-amerikanische Sozialpsychologen, David Dunning und Justin Kruger, haben sich mit der Thematik der Selbstüberschätzung beschäftigt. Als ein Resultat ihrer Arbeit, ging 1999 (im Quellenverzeichnis als Januar 2000 aufgeführt) der „Dunning-Kruger-Effekt“ in die jüngere Geschichte der Wissenschaft ein. Jede und jeder akademisierte Physio und auch viele schulisch ausgebildete Kolleg:innen sollten sich bereits, mehr oder weniger intensiv, damit auseinandergesetzt oder zumindest davon gehört haben. Was haben die beiden untersucht und was sagt deren Effekt aus? Dunning und Kruger verglichen Selbsteinschätzung und tatsächliche Fähigkeiten in verschiedenen Alltagssituationen. Das reichte vom Sinn für Humor, über grammatikalische Kenntnisse, bis hin zu logischem Denken. Interessanterweise stellten sie fest, dass je höher die Unfähigkeit war, desto selbstsicherer waren sich die Proband:innen ihrer vermeintlichen Fähigkeiten. Die vier Stufen des Dunning-Kruger Effekts sind:
Fazit: Je unfähiger eine Person ist, desto stärker überschätzt sie ihre Fähigkeiten, unterschätzt die Kompetenz anderer, kann es aber nicht erkennen. Wie kann man dem entkommen? Schwierig. Es braucht schlichtweg Kompetenz, die eigene Inkompetenz zu erkennen. Schon der griechische Philosoph Sokrates (469-399 v. C.) erkannte, „Ich weiss, dass ich nichts weiss.“ Was für eine scheinbar einfache, aber reflektierte Erkenntnis! Bloss, wo stehen wir heute? Auch 2400 Jahre später sind wir noch nicht viel weiter. Besonders in den sozialen Medien kann der Dunning-Kruger-Effekt in all seiner dramatischen Tragik fast täglich verfolgt werden. Man könnte drüber lachen, wenn es nur nicht so bitter wäre. Welche Möglichkeiten wir haben die eigene Kompetenz zu stärken, erklären wir gleich. Neben der klassischen Selbstüberschätzung wissen wir noch um einen anderen, daraus resultierenden, Effekt: die „Risikokompensation“ Sie zeigt, dass unsere Konzentration nachlässt, wenn wir uns sicher fühlen. Dazu gibt es spannende Beispiele aus der Verkehrsforschung: In den Achtzigerjahren setzte sich mehr und mehr das heute standardmässige Anti-Blockiersystem „ABS“ durch. Infolgedessen hatten sich Forscher:innen das Fahrverhalten von Taxifahrer:innen in der Stadt München angesehen und festgestellt, dass diese plötzlich sorgloser fuhren und mehr Unfälle verursacht haben. Ein ähnliches Phänomen stellte man in verschiedenen Ländern nach der jeweiligen Einführung der Gurtpflicht fest. Das teils etwas schwierige Verhältnis zwischen Auto- und Fahrradfahrer:innen wurde ebenfalls genauer untersucht. Auch hier fanden sich Hinweise auf eine Risikokompensation im Strassenverkehr. Die Autofahrer:innen fuhren durchschnittlich 8,5cm näher an Fahrradfahrer:innen heran, die einen Helm trugen und schnitten sie sogar umso mehr, je näher diese am Strassenrand fuhren. Wenn sich jedoch der oder Fahrradfahrer:in ganz selbstverständlich oder störend (je nach Sicht der Verkehrsteilnehmer:innen…) weiter links auf der Strasse befanden, wurden diese grosszügig umfahren. Umgekehrt gehen die Unfallzahlen schlagartig zurück und die Konzentration verbessert sich messbar, wenn es zu drastischen Änderungen im Strassenverkehr kommt. Wie beim Wechsel vom Links- zum Rechtsverkehr 1967 in Schweden. Dieser positive Effekt hielt für zwei Jahre an, danach normalisierten sich die Unfallzahlen leider wieder auf dem vorherigen Niveau. Fazit und Fragen zur latenten Selbstüberschätzung und Risikokompensation bei uns Therapeut:innen Wie beeinflussen Selbstüberschätzung und Risikokompensation die Arbeit mit unseren Klient:innen? Sehen wir den uns zugewiesenen und durch uns evtl. nur noch oberflächlich befundeten (Dauer)-Klient:innen als „helmtragend“, da er oder sie bereits vom Arzt oder der Ärztin voruntersucht und zugewiesen wurde? Dient uns unsere Ausbildung oder unser Studium als vermeintlicher „Sicherheitsgurt“ und all die Fortbildungen als ABS-System zur Nutzung dieser Techniken und Methoden in unserer täglichen Arbeit? Folgen wir wirklich noch einem individuellen Behandlungsansatz oder wird der Grossteil unserer Klient:innen, unabhängig von der Diagnose, direkt zum neuen Allheilmittel Kreuzheben geschickt, nur „schmerzedukativ“ vollgetextet oder arbeiten wir überwiegend nur mit einer der zu hinterfragenden Methoden wie beispielsweise MT, FDM, Dry Needling oder weiss der Teufel was? Gerade bei unseren individuell unterschiedlichen Lieblingsmethoden, wie den eben genannten diversen Allheilmitteln, zeigt sich der Dunning-Kruger Effekt ganz wunderbar. Durch generiertes Halbwissen, gepaart mit einzelnen Erfolgsmomenten (wodurch auch immer) verstärkt sich die therapeutische Selbstüberschätzung massiv und wird erst durch intensives Lernen aus belastbaren Quellen, welches die tatsächliche Kompetenz stärkt, wieder relativiert. Ich nehme mich da persönlich als beispielhaften Therapeuten. Nach meiner MT Fortbildung, welche über drei Jahre ging und insgesamt bescheuerte 120000km durch Fahrten aus der Schweiz nach Nordrhein-Westfalen zur Fortbildung und den Lerngruppen beinhaltete, habe ich in den ersten paar Jahren gefühlt Jede und Jeden manualtherapeutisch untersucht und behandelt. Sehr oft wurde dabei manipuliert. Natürlich haben sich hin und wieder auch Erfolge eingestellt, die meine anfängliche Überzeugung der MT noch verstärkt haben. Mit der Zeit musste ich aber realisieren, dass diese Therapiemethode nicht den Stellenwert in meiner Therapie besitzen sollte, den ich ihr zugestanden habe. Sie wird, wie so einige therapeutische Wunderwaffen, heillos überschätzt. Eine bittere Erkenntnis für mich, wenn ich alleine nur an den zeitlichen Aufwand und die Kosten zurückdenke. Vom Lern- und Prüfungsstress nicht zu reden. Mit dem fehlerhaften Einschätzen bzw. Überschätzen der eigenen Fähigkeiten, den daraus vermeintlich resultierenden heilenden Effekten unserer Arbeit, bei gleichzeitiger Vernachlässigung anderer Einflussfaktoren (Yellow-flags, red-flags, Nebendiagnosen, Medikamente, Trainingszustand/-verhalten, Adhärenz, psycho-soziale Einflüsse etc.) und der Fixierung auf bequeme Denkmodelle verhält es sich bei uns vermutlich leider oftmals ähnlich, wie bei den zuvor beschriebenen Verkehrsteilnehmer:innen und Versicherungsnehmer:innen. Wie also kann der Dunning-Kruger Effekt vermieden bzw. möglichst gering gehalten werden? Bescheidenheit Bleib bescheiden und demütig. Keiner weiss alles. Denk an Sokrates. Das Prinzip gilt für Dich, Deine Kolleg:innen und insbesondere auch den Chef oder die Chefin. Selbstreflexion Hinterfrage Dich und Deine Arbeit. Sei ehrlich zu Dir selber bei der Beantwortung der Frage, wo Du Dich verbessern könntest. Du musst Deine Erfolge nicht klein reden, aber solltest sie auch nicht überbewerten. Disziplin Stetes Lernen um sich weiterzubilden braucht vor allem Disziplin. Das meiste Wissen kannst Du über regelmässiges Lesen qualitativer Studien selber generieren. Das braucht keinen relevanten finanziellen Einsatz. Dazu kannst Du Kongresse besuchen, vereinzelte Fobis besuchen (wenn evidenz- und nicht eminenzbasiert) und Dich über die aktuellste Literatur auf dem Laufenden halten. Feedback Hol Dir ehrliches Feedback über Dein Wissen und die Qualität Deiner Arbeit bei Leuten ein, die das beurteilen können. Das sind eher seltener Patient:innen, dafür bei reflektierten Kolleg:innen, Zuweiser:innen und Dozent:innen. Was können wir ganz praktisch machen, um unsere therapeutische Qualität und tatsächliche Leistungsfähigkeit zu steigern, ohne sorglos zu agieren?
Zu allen Tipps können wir Euch auf Nachfrage Empfehlungen geben. Wir hoffen Ihr könnt mit diesem Blogbeitrag etwas anfangen und wünschen Euch viel Spass bei der Umsetzung! Quellen Biehl, B. (1986, 30. November). Einfluss der Risikokompensation auf die Wirkung von Verkehrssicherheitsmassnahmen am Beispiel ABS. TRB Transportation Research Board. https://trid.trb.org/view/1016024 E.V., D. G. U. (2021, 12. Juli). DGUV: Entschädigungsleistungen. DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. https://dguv.de/de/zahlen-fakten/entschaedigung/index.jsp Kruger, J. & Dunning, D. (2000, 1. Januar). Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated. . . ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/12688660_Unskilled_and_Unaware_of_It_How_Difficulties_in_Recognizing_One%27s_Own_Incompetence_Lead_to_Inflated_Self-Assessments GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. (2022) https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten/versicherungsbereiche/ueberblick-24074 Walker, I. (2007). Drivers overtaking bicyclists: Objective data on the effects of riding position, helmet use, vehicle type and apparent gender. Accident Analysis & Prevention, 39(2), 417–425. https://doi.org/10.1016/j.aap.2006.08.010 Wilde, G. J. S. & Trimpop, R. (1994). Challenges to Accident Prevention. STYX Publications, Groningen, Netherlands.
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
AutorSchreiben Sie etwas über sich. Es muss nichts ausgefallenes sein, nur ein kleiner Überblick. Archiv
September 2023
Kategorien |
|
science2practice GmbH EVIDENZBASIERTE FORTBILDUNGEN Asylstrasse 32 CH-8708 Männedorf Email: [email protected] Telefon: +41 (0) 78 642 05 97 |
|