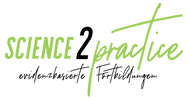|
Der Bundesrat hat am 16.08.2023 zwei Vorschläge für die zukünftige Abrechnung für Physiotherapeut*innen in der Schweiz bekannt gegeben (1). Beide Varianten, die der Bundesrat vorschlägt und die im Faktenblatt zur Tarifstruktur der Physiotherapie vom BAG beschrieben sind (2), hätten massive Einbussen für Schweizer Physiotherapeut*innen zur Folge und würden das Fortbestehen von Physiotherapie-Praxen und somit direkt die physiotherapeutische Versorgung im Land gefährden. VARIANTE 1 In der ersten Variante des Bundesratsvorschlag soll die Tarifposition 7311 zukünftig nur noch für explizite Diagnosen erlaubt sein. Weiter werden folgende Behandlungsarten mit zeitgebundenen Sitzungspauschalen definiert: Was konkret die neue Tarifposition «kurze Sitzungen» beinhalten soll bzw. bei welchen Diagnosen diese zur Anwendung kommt, ist bis dato nicht definiert. VARIANTE 2 In der 2. Variante werden beide bisherigen Tarifpositionen auf min. 20min Behandlungsdauer festgesetzt und mit identischen Taxpunkten (TP) bewertet. Für eine Verlängerung der Behandlungsdauer auf 45min (7301) resp. 75min (7311) gilt für beide Tarifpositionen 8 TP pro weitere 5min: Unklar ist, ob für administrative Tätigkeiten in Abwesenheit der Patient*innen ebenfalls +5min mit 8 TP abgerechnet werden können. Der einzige Unterschied zwischen den Tarifpositionen 7301 und 7311 läge somit bei Variante 2 in der Dauer und nicht der Komplexität der Behandlung oder der Diagnose. WIE LANGE BEHANDELN PHYSIOTHERAPEUT*INNEN AKTUELL? Physiotherapeut*innen behandeln in der Schweiz bei der Position «7301» im Durchschnitt 30min und sie verbringen zusätzlich 9min pro Patient*in mit administrativen Tätigkeiten (3). Bei der Abrechnungsposition 7311 werden durchschnittlich 40min Behandlungszeit aufgewendet und wiederum 9min Administrationszeit verbraucht. Beide Administrationszeiten werden nicht separat bzw. effektiv vergütet, sondern sind in den aktuell geltenden Taxpunktwerten enthalten (3). Einschub “Aufwändige Physiotherapie”: Nicht ganz klar scheint zu sein, dass die Therapie einer “aufwändigen Diagnose” in erster Linie mehr Fachkompetenz, eine spezialisierte Aus- und Weiterbildung sowie in der Regel mehr Berufserfahrung und eine komplexere Befund- und Behandlungsplanung voraussetzt. Eine “aufwändige Physiotherapie” dauert somit nicht unbedingt länger als eine “allgemeine Physiotherapie”, sondern verlangt eine anspruchsvollere, in der Regel engere Betreuung der Patient*innen mit aufwändigerer Vor- und Nacharbeit, z.B. interdisziplinärem Austausch, in Abwesenheit der Patient*innen. Die Reduktion des Begriffs “aufwändig” auf eine rein zeitliche Komponente ist daher nicht nachvollziehbar und in keiner Weise mit einer höheren Behandlungsqualität gleichzusetzen. KONSEQUENZ DER GEPLANTEN TARIFEINGRIFFE FÜR DIE PHYSIO-PRAXIS VARIANTE 1 Für Praxen, welche die aktuelle Position 7301 mit 25-30min Behandlungszeit oder die Position 7311 mit 45min planen, wird sich ab 1. Januar 2025 nicht viel ändern. Oder anders gesagt, es verbessert sich nichts. Für Praxen mit kürzeren Behandlungszeiten bei Tarifposition 7311 könnten sich ab 2025 jedoch folgende Änderungen bzgl. Umsatz pro Stunde ergeben (Abbildung 1): VARIANTE 2 Unabhängig von der Tarifposition bzw. unabhängig davon, ob die/der Patient*in eine aufwändige Therapie benötigt, würden bei Variante 2 sowohl für 7301 als auch für 7311 nur noch 32 Taxpunkte für die Grundbehandlungszeit von 20min verrechenbar. Somit sind auch bei Variante 2 mit erheblichen Umsatzeinbussen bei Termindauer, welche der aktuellen Norm in der Schweiz entsprechen, zu rechnen (Abbildung 2). ACHTUNG: Der Umsatz pro Behandlung reduziert sich bei 75min-Terminen um CHF 14 bzw. ca. 20% ab 2025. Wird für die Position 7311 60min Behandlungszeit kalkuliert, entstehen vermeintlich zwar ca. 24.7% höhere Einnahmen, nur kommt derselbe Taxpunktwert wie für die Position 7301 zur Anwendung. Wenn man davon ausgeht, dass die Mehrheit der Therapeut*innen im 30min-Takt arbeiten und dafür bei der Tarifposition 7311 aktuell mit 77 Taxpunkten abrechnen können, ist die Reduktion auf 48 Taxpunkte für den gleichen Zeitraum eine direkte Umsatzeinbusse von 38%. FAZIT Wenn eine dieser beiden Varianten, welche der Bundesrat als «minimaler Eingriff» in die Tarifstruktur bezeichnet, zur Anwendung kommt, kann sich jede Praxis die zukünftigen Umsatzeinbussen ausrechnen. Es gibt bis dato keine Evidenz, dass eine zeitgebundene Therapie eine verbesserte Behandlungsqualität bewirkt. RANDNOTIZ Ob Behandlungs- und Administrationszeiten in Physiotherapie-Praxen heutzutage effektiv genutzt werden bzw. wie diese effizienter gestaltet werden könnten, wird hier nicht weiter diskutiert oder ausgeführt. Dazu verweisen wir bereits auf einen Blogbeitrag, der nächstens bei science2practice publiziert wird. QUELLEN
5 Comments
«Der Preis für eine Physiotherapie-Sitzung ist veraltet (1996), der Taxpunktwert wurde nur 2014 bzw. 2016 erhöht (+ 8.5 %); die Kosten für den Praxisbetrieb stiegen seither jedoch um rund 25%» Physioswiss, 2022 STEIGENDE KOSTEN IN ALLEN BRANCHEN Abbildung 1: Prozentuale Preissteigerung zwischen 1996 und 2022.*, 1996–2021; **, 2009–2022. KONSEQUENZ TARIFVORSCHLAG BUNDESRAT FÜR DIE PHYSIOTHERAPIE
WERDE JETZT AKTIV: WWW.FAIRE-PHYSIO-TARIFE.CH/ Für mehr Infos zum Tarifvorschlag des Bundesrates siehe auch: Statement von science2practice zum Vorschlag des Bundesrates zur Vergütung in der Physiotherapie QUELLEN
Statement von science2practice zum Vorschlag des Bundesrates zur Vergütung in der Physiotherapie3/9/2023 Etwa 20% der Schweizer Bevölkerung werden mindestens einmal jährlich von ärztlicher Seite in die physiotherapeutische Behandlung überwiesen. (1) Trotzdem machen diese Therapien nur ca. 3.6% der Gesamtkosten im Schweizer Gesundheitssystem aus.
Interessanterweise liegt der Anteil der Krankenkassenadministration mit 5% an den Gesamtkosten sogar ca. 40% höher, als die Kosten für Physiotherapie in der Schweiz. «Natürlich» wird von entsprechender Seite im gleichen Atemzug darauf hingewiesen, dass solch ein kleiner Prozentsatz keine Auswirkungen auf die Versichertenprämien hätte. (2) Schwer verständlich wird es aber, dass von Seiten der Kostenträger und ihren politischen Unterstützern im Bundesrat, die 3,6% der Physiotherapie gänzlich anders bewertet und ein ganzer Berufsstand aktiv bekämpft, diskreditiert und schlichtweg in seiner Existenz bedroht wird. Ist unsere Bewertung eine emotionale Überbewertung und Jammern auf hohem Niveau? Ganz klar: Nein! Die Fakten
Die Effekte moderner evidenzbasierter Physiotherapie
Folgen für den Beruf und die PatientInnen, wenn der aktuelle Vorschlag des Bundesrates angenommen wird:
Was wir fordern
Wie ist Deine/Ihre Meinung? Wir freuen uns auf die Kommentare und bedanken uns für Deine/Ihre Zeit. Quellen 1. Bundesamt für Statistik (abgerufen am 31.08.2023) https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/andere-leistungserbringer.html 2. Aschwanden, E. & Schäfer, F. (2023, 29. August). Gesundheitswesen: Curafutura-Präsident Konrad Graber kritisiert Kantone. Neue Zürcher Zeitung. https://www.nzz.ch/schweiz/alain-berset-soll-ins-trockene-bringen-was-er-noch-kann-ld.1753610?reduced=true 3. Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2017, 5. Juni). Prehabilitation: „Fit“ werden für eine Operation. Deutsches �rzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/archiv/189303/Prehabilitation-Fit-werden-fuer-eine-Operation 4. Steindorf, K., Schmidt, M. E. & Zimmer, P. (2018). Sport und Bewegung mit und nach Krebs – Wer profitiert, was ist gesichert? Deutsche Medizinische Wochenschrift. https://doi.org/10.1055/s-0043-106885 von David Schmidt
Bei der Arbeit mit unangenehmen bzw. „herausfordernden“ Klient:innen kann ein altes chinesisches Sprichwort gelten: "Wenn Du Deinen Feind nicht besiegen kannst, umarme ihn.“ Jetzt wäre es wahnsinnig weit hergeholt, bei solchen Mitmenschen direkt von „Feinden“ zu sprechen – oder einer Umarmung. Einer feindlichen Therapeut:innen-Patient:innen-Beziehung wären wir bestenfalls bereits lange vorher aktiv aus dem Weg gegangen. Leider lassen sich unerwünschte Beziehungen aber nicht immer verhindern. Solche Mitmenschen können unser eigenes Gemüt enorm strapazieren und uns bei der Arbeit unangenehm zur Last fallen. Ein Zustand, den es zu vermeiden gilt und den wir teilweise aktiv verändern können. Welche einfach durchzuführenden Optionen haben wir in diesen Situationen? Welche kleinen Tricks kennt die Psychologie? Die unten aufgeführten Arbeiten haben sich mit der buddhistischen Meditationsform, der „Loving kindness“ („liebende Güte“) auseinandergesetzt. Keine Angst! Es bedarf dafür keiner geschorenen Köpfe, ihr müsst keine orangen Gewänder tragen oder Gebete vor Euch her murmeln. Kein Mensch bekommt von Euren Gedankenspielen etwas mit. Vielen von uns fällt es bereits schwer, uns selbst etwas Gutes zu wünschen. Bei Menschen oder Tieren, die wir gerne haben, gelingt uns das besonders am Anfang deutlich besser. Bei Leuten, die wir aus was für Gründen auch immer ablehnen, wird es dagegen besonders schwer. Für diese Übung können zum Beispiel Sätze benutzt werden wie,
Barbara Fredrickson, eine Psychologin aus den USA, hat dazu die „Broaden-and-build-Theorie“ verfasst. Ihr zufolge verbessert der konzentrierte Fokus die eigene Zufriedenheit, Ruhe und Ausgeglichenheit. All die Punkte, bei welchen uns so manche KlientInnen teils enorm auf die Probe stellen. In der klinischen Psychologie wird diese Meditations- bzw. Konzentrationsform therapeutisch gegen Gedankenspiralen, Depressionen und Ängste eingesetzt.
Diese Form der Meditations- bzw. Konzentrationsform ist zwar eine klassisch buddhistische Technik, aber ihre Lehre ist universell. „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst.“ Denkt mal bei Eurem nächsten Goldstück daran. Bestenfalls seid ihr dann aber auch schon entsprechend vorbereitet. Es spricht nichts dagegen, schon jetzt damit anzufangen. ;-) Viel Spass bei der Umsetzung und Danke für Euer Interesse! Quellen Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., Coffey, K. A., Pek, J. & Finkel, S. M. (2008). Open hearts build lives: Positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. Journal of Personality and Social Psychology, 95(5), 1045–1062. https://doi.org/10.1037/a0013262 Graser, J. & Stangier, U. (2018). Compassion and Loving-Kindness Meditation: An Overview and Prospects for the Application in Clinical Samples. Harvard Review of Psychiatry, 26(4), 201–215. https://doi.org/10.1097/hrp.0000000000000192 Trautwein, F. M., Kanske, P., Böckler, A. & Singer, T. (2020). Differential benefits of mental training types for attention, compassion, and theory of mind. Cognition, 194, 104039. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2019.104039 von David Schmidt
Deutschlands Unfallversicherer kommen jährlich für Schäden in Höhe von ca. 60 Milliarden Euro auf. Warum sind deren Ursachen für unsere Therapie relevant und was können wir verbessern? Fehlende Konzentration, bedingt durch Selbstüberschätzung und falsche Risikobewertung, gilt als eine der zentralen Voraussetzungen für das Entstehen von Schäden und Verletzungen. Typisch menschliche Züge sorgen dafür, dass wir unsere Konzentration schleifen lassen. Wir überschätzen unsere eigenen Fähigkeiten und unterschätzen unsere Schwächen. Ein gefährlicher Mix, für den die Psychologie den Begriff der „Überlegenheitsillusion“ nutzt. Solche Verzerrungen verbessern zwar unser Wohlbefinden, machen uns optimistischer und generieren mehr Selbstvertrauen, schaffen aber leider auch die Voraussetzungen für unnötige Gefahren und Schäden. Entscheidend ist: Wer glaubt alles problemlos hinzubekommen, gefährdet schlussendlich sich und andere. Das gilt für sorglose Pilot:innen, betrunkene Autofahrer:innen und Opa auf der Leiter am Apfelbaum. Natürlich aber auch für unsere Arbeit mit Klient:innen. Beispiele aus der Wissenschaft gefällig?
Diese Liste liesse sich noch weiterführen. Es wird nur nicht besser. Zwei US-amerikanische Sozialpsychologen, David Dunning und Justin Kruger, haben sich mit der Thematik der Selbstüberschätzung beschäftigt. Als ein Resultat ihrer Arbeit, ging 1999 (im Quellenverzeichnis als Januar 2000 aufgeführt) der „Dunning-Kruger-Effekt“ in die jüngere Geschichte der Wissenschaft ein. Jede und jeder akademisierte Physio und auch viele schulisch ausgebildete Kolleg:innen sollten sich bereits, mehr oder weniger intensiv, damit auseinandergesetzt oder zumindest davon gehört haben. Was haben die beiden untersucht und was sagt deren Effekt aus? Dunning und Kruger verglichen Selbsteinschätzung und tatsächliche Fähigkeiten in verschiedenen Alltagssituationen. Das reichte vom Sinn für Humor, über grammatikalische Kenntnisse, bis hin zu logischem Denken. Interessanterweise stellten sie fest, dass je höher die Unfähigkeit war, desto selbstsicherer waren sich die Proband:innen ihrer vermeintlichen Fähigkeiten. Die vier Stufen des Dunning-Kruger Effekts sind:
Fazit: Je unfähiger eine Person ist, desto stärker überschätzt sie ihre Fähigkeiten, unterschätzt die Kompetenz anderer, kann es aber nicht erkennen. Wie kann man dem entkommen? Schwierig. Es braucht schlichtweg Kompetenz, die eigene Inkompetenz zu erkennen. Schon der griechische Philosoph Sokrates (469-399 v. C.) erkannte, „Ich weiss, dass ich nichts weiss.“ Was für eine scheinbar einfache, aber reflektierte Erkenntnis! Bloss, wo stehen wir heute? Auch 2400 Jahre später sind wir noch nicht viel weiter. Besonders in den sozialen Medien kann der Dunning-Kruger-Effekt in all seiner dramatischen Tragik fast täglich verfolgt werden. Man könnte drüber lachen, wenn es nur nicht so bitter wäre. Welche Möglichkeiten wir haben die eigene Kompetenz zu stärken, erklären wir gleich. Neben der klassischen Selbstüberschätzung wissen wir noch um einen anderen, daraus resultierenden, Effekt: die „Risikokompensation“ Sie zeigt, dass unsere Konzentration nachlässt, wenn wir uns sicher fühlen. Dazu gibt es spannende Beispiele aus der Verkehrsforschung: In den Achtzigerjahren setzte sich mehr und mehr das heute standardmässige Anti-Blockiersystem „ABS“ durch. Infolgedessen hatten sich Forscher:innen das Fahrverhalten von Taxifahrer:innen in der Stadt München angesehen und festgestellt, dass diese plötzlich sorgloser fuhren und mehr Unfälle verursacht haben. Ein ähnliches Phänomen stellte man in verschiedenen Ländern nach der jeweiligen Einführung der Gurtpflicht fest. Das teils etwas schwierige Verhältnis zwischen Auto- und Fahrradfahrer:innen wurde ebenfalls genauer untersucht. Auch hier fanden sich Hinweise auf eine Risikokompensation im Strassenverkehr. Die Autofahrer:innen fuhren durchschnittlich 8,5cm näher an Fahrradfahrer:innen heran, die einen Helm trugen und schnitten sie sogar umso mehr, je näher diese am Strassenrand fuhren. Wenn sich jedoch der oder Fahrradfahrer:in ganz selbstverständlich oder störend (je nach Sicht der Verkehrsteilnehmer:innen…) weiter links auf der Strasse befanden, wurden diese grosszügig umfahren. Umgekehrt gehen die Unfallzahlen schlagartig zurück und die Konzentration verbessert sich messbar, wenn es zu drastischen Änderungen im Strassenverkehr kommt. Wie beim Wechsel vom Links- zum Rechtsverkehr 1967 in Schweden. Dieser positive Effekt hielt für zwei Jahre an, danach normalisierten sich die Unfallzahlen leider wieder auf dem vorherigen Niveau. Fazit und Fragen zur latenten Selbstüberschätzung und Risikokompensation bei uns Therapeut:innen Wie beeinflussen Selbstüberschätzung und Risikokompensation die Arbeit mit unseren Klient:innen? Sehen wir den uns zugewiesenen und durch uns evtl. nur noch oberflächlich befundeten (Dauer)-Klient:innen als „helmtragend“, da er oder sie bereits vom Arzt oder der Ärztin voruntersucht und zugewiesen wurde? Dient uns unsere Ausbildung oder unser Studium als vermeintlicher „Sicherheitsgurt“ und all die Fortbildungen als ABS-System zur Nutzung dieser Techniken und Methoden in unserer täglichen Arbeit? Folgen wir wirklich noch einem individuellen Behandlungsansatz oder wird der Grossteil unserer Klient:innen, unabhängig von der Diagnose, direkt zum neuen Allheilmittel Kreuzheben geschickt, nur „schmerzedukativ“ vollgetextet oder arbeiten wir überwiegend nur mit einer der zu hinterfragenden Methoden wie beispielsweise MT, FDM, Dry Needling oder weiss der Teufel was? Gerade bei unseren individuell unterschiedlichen Lieblingsmethoden, wie den eben genannten diversen Allheilmitteln, zeigt sich der Dunning-Kruger Effekt ganz wunderbar. Durch generiertes Halbwissen, gepaart mit einzelnen Erfolgsmomenten (wodurch auch immer) verstärkt sich die therapeutische Selbstüberschätzung massiv und wird erst durch intensives Lernen aus belastbaren Quellen, welches die tatsächliche Kompetenz stärkt, wieder relativiert. Ich nehme mich da persönlich als beispielhaften Therapeuten. Nach meiner MT Fortbildung, welche über drei Jahre ging und insgesamt bescheuerte 120000km durch Fahrten aus der Schweiz nach Nordrhein-Westfalen zur Fortbildung und den Lerngruppen beinhaltete, habe ich in den ersten paar Jahren gefühlt Jede und Jeden manualtherapeutisch untersucht und behandelt. Sehr oft wurde dabei manipuliert. Natürlich haben sich hin und wieder auch Erfolge eingestellt, die meine anfängliche Überzeugung der MT noch verstärkt haben. Mit der Zeit musste ich aber realisieren, dass diese Therapiemethode nicht den Stellenwert in meiner Therapie besitzen sollte, den ich ihr zugestanden habe. Sie wird, wie so einige therapeutische Wunderwaffen, heillos überschätzt. Eine bittere Erkenntnis für mich, wenn ich alleine nur an den zeitlichen Aufwand und die Kosten zurückdenke. Vom Lern- und Prüfungsstress nicht zu reden. Mit dem fehlerhaften Einschätzen bzw. Überschätzen der eigenen Fähigkeiten, den daraus vermeintlich resultierenden heilenden Effekten unserer Arbeit, bei gleichzeitiger Vernachlässigung anderer Einflussfaktoren (Yellow-flags, red-flags, Nebendiagnosen, Medikamente, Trainingszustand/-verhalten, Adhärenz, psycho-soziale Einflüsse etc.) und der Fixierung auf bequeme Denkmodelle verhält es sich bei uns vermutlich leider oftmals ähnlich, wie bei den zuvor beschriebenen Verkehrsteilnehmer:innen und Versicherungsnehmer:innen. Wie also kann der Dunning-Kruger Effekt vermieden bzw. möglichst gering gehalten werden? Bescheidenheit Bleib bescheiden und demütig. Keiner weiss alles. Denk an Sokrates. Das Prinzip gilt für Dich, Deine Kolleg:innen und insbesondere auch den Chef oder die Chefin. Selbstreflexion Hinterfrage Dich und Deine Arbeit. Sei ehrlich zu Dir selber bei der Beantwortung der Frage, wo Du Dich verbessern könntest. Du musst Deine Erfolge nicht klein reden, aber solltest sie auch nicht überbewerten. Disziplin Stetes Lernen um sich weiterzubilden braucht vor allem Disziplin. Das meiste Wissen kannst Du über regelmässiges Lesen qualitativer Studien selber generieren. Das braucht keinen relevanten finanziellen Einsatz. Dazu kannst Du Kongresse besuchen, vereinzelte Fobis besuchen (wenn evidenz- und nicht eminenzbasiert) und Dich über die aktuellste Literatur auf dem Laufenden halten. Feedback Hol Dir ehrliches Feedback über Dein Wissen und die Qualität Deiner Arbeit bei Leuten ein, die das beurteilen können. Das sind eher seltener Patient:innen, dafür bei reflektierten Kolleg:innen, Zuweiser:innen und Dozent:innen. Was können wir ganz praktisch machen, um unsere therapeutische Qualität und tatsächliche Leistungsfähigkeit zu steigern, ohne sorglos zu agieren?
Zu allen Tipps können wir Euch auf Nachfrage Empfehlungen geben. Wir hoffen Ihr könnt mit diesem Blogbeitrag etwas anfangen und wünschen Euch viel Spass bei der Umsetzung! Quellen Biehl, B. (1986, 30. November). Einfluss der Risikokompensation auf die Wirkung von Verkehrssicherheitsmassnahmen am Beispiel ABS. TRB Transportation Research Board. https://trid.trb.org/view/1016024 E.V., D. G. U. (2021, 12. Juli). DGUV: Entschädigungsleistungen. DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. https://dguv.de/de/zahlen-fakten/entschaedigung/index.jsp Kruger, J. & Dunning, D. (2000, 1. Januar). Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated. . . ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/12688660_Unskilled_and_Unaware_of_It_How_Difficulties_in_Recognizing_One%27s_Own_Incompetence_Lead_to_Inflated_Self-Assessments GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. (2022) https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten/versicherungsbereiche/ueberblick-24074 Walker, I. (2007). Drivers overtaking bicyclists: Objective data on the effects of riding position, helmet use, vehicle type and apparent gender. Accident Analysis & Prevention, 39(2), 417–425. https://doi.org/10.1016/j.aap.2006.08.010 Wilde, G. J. S. & Trimpop, R. (1994). Challenges to Accident Prevention. STYX Publications, Groningen, Netherlands.  von David Schmidt Wir alle grübeln. Manche mehr, andere weniger. Aber wir kennen es alle und unsere Klient:innen kennen es leider nur zu gut. In der Regel führt Grübeln zu nichts, kann aber sehr belastend und sogar Teil einer depressiven Erkrankung sein. Und demzufolge auch Einfluss auf unseren Therapieerfolg haben. Woher das Grübeln kommt, welche Gegenmassnahmen empfohlen werden und warum ein Erdbeben anfangs eine wesentliche Hilfe für die Wissenschaft war, möchten wir Euch hier aufzeigen. Wir alle haben bekanntlich ein Gehirn. Wenngleich uns dieser Fakt nicht bei Jedem oder Jeder direkt auffallen mag. Unsere Masse im Schädel ist zu mehr in der Lage, als uns nur Schmerzen, Hunger, Kälte und andere Gefahren erkennen zu lassen. Sie erlaubt uns zu denken, positive und negative Gefühle zu entwickeln, diese zu empfangen und auch auszudrücken bzw. darauf zu reagieren. Und zu grübeln. Angelehnt an Paul Watzlawicks (österreichischer Philosoph, Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler, 1921-2007) berühmte Aussage, „Wir können nicht nicht kommunizieren“, können wir aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupten, dass wir „nicht nicht denken können“. Prof. Annette van Randenborgh von der Fachhochschule Münster und ihr Kollege Prof. Thomas Ehring von der Universität Münster haben dazu einen wunderbaren Vergleich aus der Tierwelt genutzt: Unser Grübeln ähnelt ihnen zufolge sehr der Ernährungsweise von Kühen. Zugegeben ein etwas befremdlicher Vergleich, aber er passt erstaunlich gut. Ständiges „wiederkäuen“ unserer Gedanken in Ruhezeiten, führt zum immer wiederkehrenden Gedankenkreisen: dem Grübeln. Die Biologie nutzt für das Wiederkäuen die Bezeichnung „Rumination“. Die Psychologie hat diesen Begriff tatsächlich eins zu eins übernommen und beschreibt das unproduktive Grübeln bzw. „Gedankenkreisen“ über Pech, Missgeschicke und widerfahrenes Unglück als ebendiese Rumination. Was ist ruminieren? Beim ruminieren sind wir oft mit bereits Vergangenem beschäftigt, kreisen gedanklich lange um Dinge, die nicht optimal bzw. schief gelaufen sind und beschäftigen uns exzessiv mit unseren, vermeintlich, eigenen Schwächen. Während Kühe in aller Regel beim ruminieren tiefenentspannt sind, macht uns das Grübeln oftmals traurig und wir fühlen uns unseren „eigenen unkontrollierbaren Gedanken schutzlos ausgeliefert“ (Papageorgiou & Wells, 2003). Warum grübeln wir? Es ist ein Phänomen! Einerseits empfinden es die Betroffenen als effektives Problemlösen und gleichzeitig geben sie in Befragungen starke negative Überzeugungen zum Grübeln an. Sie scheinen zwar unterbewusst zu wissen, dass ihnen grübeln nicht guttut, allerdings fehlen ihnen die Mittel und Strategien diesem Teufelskreis zu entkommen. (Watkins & Baracaia, 2001; Papageorgiou & Wells, 2003). Was sagt die Wissenschaft? In einer frühen Arbeit von Nolen-Hoeksema & Morrow (1991) konnte erstmalig festgestellt werden, dass Menschen, die grübeln, eher an Depressionen erkranken als Menschen, die sich für die Methode des Ablenkens entscheiden. Des Weiteren waren mehr Frauen, die eher ruminierten, als Männer, welche zur Ablenkung neigten, betroffen. Im Verlauf dieser Forschungsarbeit konnte Nolen-Hoeksema ein gerade stattgefundenes Erdbeben im Raum San Francisco in ihre Befragung einbauen und einen vergleichenden Nachweis zu depressiven Symptomen vor dem Erdbeben, sechs Wochen und drei Monate danach erbringen. Grübelnde Menschen gaben zu den genannten Zeitpunkten ein signifikant höheres Level an depressiven Symptomen an. Ehring und Watkins konnten 2008 die genannten Erkenntnisse dahingehend bestätigen, dass Rumination das Risiko an einer Depression zu erkranken erhöht, speziell wenn die Betroffenen einer Belastung ausgesetzt sind. Bei bereits depressiv Erkrankten verschlechtert sich zudem die Prognose und die Erkrankung verläuft tendenziell länger und schwerer. Rumination spielt auch bei anderen psychischen Erkrankungen, wie sozialen Ängsten oder generalisierter Angststörung, Schlafstörungen und PTBS, eine Rolle. Welche Anzeichen für übermässiges Grübeln gibt es? Zunächst einmal sei klargestellt: Intensives Denken führt nicht automatisch zu einer pathologischen Rumination und klinisch manifesten Depressionen. Das Hirn darf und sollte auch weiterhin gut genutzt werden. Ein Anzeichen für eine negative Rumination ist es, wenn das Gedankenkreisen zu keinem Resultat führt. Wenn das Grübeln unproduktiv ist. Unproduktives und produktives ruminieren ist laut Watkins (2008) von zwei Faktoren abhängig. Erstens: Handelt es sich um ein positiv oder negativ besetztes Thema? Dieses wird bestimmt vom Inhalt der Grübelgedanken und der Stimmung der betroffenen Person. Sollte die Thematik zu belastend sein, sind konstruktive Ergebnisse leider in weiter Ferne und unwahrscheinlich. Zweitens: In welchem Gemütszustand befindet sich die Person beim Start des Grübelns? Wenn die Person in einem traurigen Zustand beginnt zu grübeln, zeigen sich eher negative Folgen, als wenn der Grübelprozess in neutraler oder positiver Stimmung gestartet würde. Ein weiteres Anzeichen für ein unverhältnismässiges Gedankenkreisen ist die Fokussierung auf abstrakte und nicht spezifische bzw. konkrete Gedanken. Abstrakte Gedanken versuchen allgemeine Regeln für gewisse Situationen zu schaffen und zeichnen sich dadurch aus, dass sie häufig auf «Warum-Fragen» basieren, während konstruktive Gedanken sich mehr auf spezifische Situation mit «Wie- oder Was-Fragen» konzentrieren. «Wie-» und «Was-Fragen» ermöglichen die Planung und Durchführung von spezifischen Handlungen. Das Gedankenkreisen ist bei dieser Art von Fragen, im Gegensatz zu abstrakten «Warum-Fragen», produktiv. Wie erleben Betroffene ihren Alltag? Abgesehen davon, dass Rumination nicht nur ein Begleitsymptom der Depression sein und diese sogar verursachen kann, haben Betroffene noch andere Einschränkungen im Alltag zu bewältigen. Donaldson & Lam (2004) wiesen grössere Schwierigkeiten beim Lösen zwischenmenschlicher Probleme nach. Schlechtere Leistungen bei Konzentrationsaufgaben wie Korrekturlesen (Lyubomirsky, 2003) und größere Schwierigkeiten beim Treffen von Entscheidungen (van Randenborgh, de Jong-Meyer & Hüffmeier, 2009) waren andere Erkenntnisse zu grübelbedingten Einschränkungen. Darüber hinaus zeigten sich nach einer Phase des Grübelns Beeinträchtigungen des Gedächtnisses: Persönliche Erinnerungen fielen negativer aus und die Teilnehmer:innen hatten größere Schwierigkeiten, sich an spezifische Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit zu erinnern (Williams et al., 2007). Wie führt Grübeln zu einer Depression? Noelen-Hoeksema hat bereits 1991 und erneut 2008, mit ihren Kolleginnen Wisco und Lyubomirsky, den Weg vom Grübeln zur Depression wie folgt beschrieben: Bei trauriger Stimmung denken viele Betroffene über die zugrunde liegende Ursache nach und kommen ins Grübeln. Diese Fokussierung verstärke aber die Traurigkeit, da über weitere Fehler und Missgeschicke aus der Vergangenheit nachgedacht würde. Dadurch steige die «Motivation» für zusätzliches ruminieren. Durch dieses ständige Grübeln wird die Gefahr falscher Alltagsentscheidungen akuter, was erneut zu Stress und Missgeschicken führt. Ein Teufelskreis. Welche therapeutischen Strategien werden empfohlen? Vorweg: Die beliebten Hinweise, «Denk doch nicht so viel nach» oder «Grübel doch nicht dauernd», funktionieren, völlig überraschend, in der Regel nicht. Im Gegenteil. Das Problem verstärkt sich (Wenzlaff & Wegner, 2000). Auch Ablenkung funktioniert nicht gut genug. Was sich hingegen als effektiv erwiesen hat, ist das aus dem Buddhismus stammende meditative «Achtsamkeitstraining» (Broderick, 2005). Achtsamkeitstraining kann auch als «Akzeptanztraining» verstanden werden und ist mittlerweile recht gut erforscht. Es zeigen sich sogar, nur so am Rande erwähnt, positive Effekte in der Onkologie. Aber das wäre einen eigenen Blogbeitrag wert… Eine achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie, welche zwingend von Psycholog:innen/Psychotherapeut:innen angewendet werden sollte, ist bereits jetzt ein Eckpfeiler in der Therapie von Depressionserkrankungen (Segal, Williams & Teasdale, 2018). Kuyken et al. konnten 2010 nachweisen, dass diese Therapieform den Betroffenen Wege aus der Rumination aufzeigt und dadurch die Wiedererkrankungsrate bei Depressiven senkt. Des Weiteren wird den Betroffenen empfohlen, auf «Warum-Fragen» möglichst zu verzichten. Beispiel: «Warum geht es mir schlecht»? Besser wäre: «Was kann ich tun damit es mir jetzt besser geht?» oder «Wie kann ich diese Situation beim nächsten Mal vermeiden?» Wer sich von Euch näher mit dem Konzept «Achtsamkeit» befassen möchte, dem sei zum Schluss das folgende Buch und Interview des US-Amerikaners Jon Kabat-Zinn ans Herz gelegt:
Kabat-Zinn hat unteranderem das MBSR (Mindfulness-Based-Stress-Reduction) program, ein achtsamkeits-orientiertes Stressreduktionsprogramm entwickelt. Die Teilnehmenden lernen Körperempfindungen, Gedanken, Gefühle oder Sinneswahrnehmungen bewusst wahrzunehmen. Ziel ist es, sich nicht mehr von seinen Gedanken „entführen“ zu lassen, etwa durch Geschichten vom Vortag oder Befürchtungen über das Morgen, sondern bei dem zu bleiben, was gerade ist. Danke das Du es bis hier geschafft hast. Haben Dir die Informationen geholfen? Denkst Du, dass Du die Tipps und Hinweise anwenden kannst? Hast Du etwas zu kritisieren, Verbesserungs- oder Themenvorschläge? Schreib uns an info@science2practice.ch, auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Wir freuen uns auf Deine Nachricht! Quellen
von David Schmidt
Es ist ernüchternd. Wir sind mittlerweile mitten in der 4. Welle in Deutschland und 5. Welle in der Schweiz. Täglich wird ein trauriger Inzidenzrekord nach dem anderen gerissen. Die Spitäler füllen sich erneut erschreckend schnell, Pflegefachkräfte und Ärzt:innen arbeiten weiterhin am Limit und darüber hinaus, unsere Politik weiss offenbar nicht wie sie reagieren soll und unsere dauerverwöhnte Gesellschaft ist gespalten wie selten zuvor. In Deutschland sind nur zwei Drittel und in der Schweiz sogar nur etwas mehr als 60% der Volljährigen zweimal geimpft. Von den dringend nötigen Boosterimpfungen, der dritten und wahrscheinlich komplettierenden Impfung, ist man hier in der Schweiz noch weit entfernt. Diese Quote ist, laut der breiten Masse an Virolog:innen, nicht ausreichend für eine nachhaltige und erfolgreiche Bekämpfung des Coronavirus. Hätten wir eine genügend hohe Impfrate erreicht, hätten wir sehr wahrscheinlich die Pandemie mittlerweile grösstenteils hinter uns und oder zumindest unter Kontrolle. Leider ist dem nicht so. Wir sind aktuell schlimmer dran, als je zuvor in den letzten zwei Jahren. Es fällt mir schwer diesen Blog zu schreiben. Die Thematik und die täglichen Diskussionen ermüden und ärgern mich zutiefst. Es wird mir eventuell nicht gelingen, diesen Text vollumfänglich wertungs- bzw. emotionsfrei zu schreiben. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum und wieso weite Teile der Bevölkerung die Vorteile der Impfung nicht sehen können, nicht sehen wollen und nicht selten absurde Behauptungen zu diesem Thema aufstellen. Das Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, die gefühlte Abwesenheit des gesunden Menschenverstands und eine, zumindest zu vermutende, fehlende Empathie gegenüber den Mitmenschen scheinen in der Gruppe Ungeimpfter offenbar weit verbreitet und für mich schwierig zu verstehen. Es gibt daher gute Gründe, uns die Motive hinter der Impfverweigerung anzuschauen und mögliche Anreize für die Impfung darzustellen. Wie ist der derzeitige Stand und was empfiehlt die Wissenschaft? Einen interessanten Einblick gibt dazu die Gemeinschaftsstudie COSMO (COvid-19 Snapshot Monitoring) unter Federführung von Cornelia Betsch von der Universität Erfurt (projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020). Dieses Projekt versucht wiederholt und in regelmässigen Intervallen den aktuellen „psychologischen Ist-Zustand“ in der deutschen Bevölkerung zu erfassen, entsprechende Vorschläge für Kommunikationsmassnahmen mit korrektem, hilfreichen Wissen anzubieten und Falschinformationen und Aktionismus vorzubeugen. Die Studie soll deutschen Behörden, Medien und der Bevölkerung dazu dienen, die psychologischen Herausforderungen der COVID-19 Epidemie besser einzuschätzen und im günstigsten Falle auch zu bewältigen. Die Ergebnisse und Empfehlungen werden laufend angepasst und zu keiner Zeit in Stein gemeisselt. Basierend auf den Erhebungen vom 19.-20.10.21 und 02.-03.11.21 fasst die Erfurter Forschungsgruppe die aktuellen Resultate wie folgt zusammen:
Die Thüringer Foscher:innen empfehlen unteranderem:
Was wissen wir zu den Gründen die Ungeimpfte vorbringen und können diese überhaupt noch zu einer Impfung motiviert werden? „Wichtiger Hinweis: Bei der Bewertung der folgenden Ergebnisse ist zu beachten, dass die Befragten dieser Studie der Impfung grundsätzlich etwas positiver gegenüberstanden als die durchschnittliche Bevölkerung und nur der Personenkreis im Alter von 18-74 Jahren befragt wurde. Dies kann zu einer zu positiven Verzerrung der Ergebnisse führen (Unterschätzung der Impf-Unwilligen und evtl. Überschätzung der erreichbaren Impfquote) und repräsentiert nicht alle Personen, welche geimpft werden könnten.“ Unter den derzeit Ungeimpften lehnen weiterhin ca. 64% die Impfung kategorisch ab, während nur 7% der Befragten potenziell impfbereit wären. Der Grossteil der zu impfenden Bürger:innen scheint bereits erreicht und die Impfquote daher nur noch marginal nach oben verschiebbar. Hinsichtlich der Impfentscheidung zeigen sich keine relevanten Unterschiede bzgl. des Geschlechts, des Bildungsgrades oder der Berufswahl. Auffällig ist dagegen, das Desinteresse am Impfschutz im Osten Deutschlands und bei jüngeren Bundesbürger:innen. Eine weitere Gruppe, die sich unterdurchschnittlich oft impfen lässt, ist jene der Migrant:innen. Offenbar fehlt der Zugang oder die adäquaten Argumente, welche die Vorteile für den Eigen- und Fremdschutz gut erklären können. Die Daten zeigen, dass Ungeimpfte weniger Vertrauen in die Impfung haben, eher als „Trittbrettfahrer“ fungieren und sich weniger interessiert am Schutz Dritter zeigen. Bei den verbliebenen 7% potenziell Impfbereiten scheinen vor allem praktische Barrieren im Weg zu stehen. Dieses gilt es bei anstehenden Impfkampagnen zu beachten! Wie könnten diese 7% Impfwilligen erreicht werden? Informationen in einfacher und klar verständlicher Muttersprache vermitteln. Im besten Fall durch glaubwürdige Mitglieder der spezifischen Migrationsgruppen. Beispielsweise über Sportler:innen, Influencer:innen, Musiker:innen, Geistliche etc. Die Befragten wünschen sich mehr Informationen zu den Inhaltsstoffen der Impfungen, einen Vergleich zwischen den Präparaten, detailliertere Informationen zu Impfdurchbrüchen, Nebenwirkungen und den viel diskutierten, potenziellen „Langzeitfolgen“. Folgende Schritte sollten von den besonders glaubwürdig eingestuften Instanzen (Robert-Koch-Institut und Spitälern) vorgenommen werden:
Das wir von den in Deutschland ca. 30% und schweizweit 35% Ungeimpften nur deren 7% noch erreichen können, ist für die Pandemieprognose katastrophal. Wie können wir dem, neben den bereits genannten Möglichkeiten, noch anders begegnen? - Wahrscheinlich leider nur mit verpflichtenden Massnahmen. Da die Möglichkeit einer Impfpflicht, wie in Österreich (allgemeine Impfpflicht), Frankreich oder Italien (jeweils bestimmte Berufsgruppen), in Deutschland und der Schweiz politisch schwierig durchzusetzen ist und sich die politisch Verantwortlichen bisher vor zu unpopulären Entscheidungen gedrückt haben und auch weiterhin tun, scheint es zumindest kurzfristig auf eine 2G, 2G+ oder 3G+ Lösung hinauszulaufen. Allerdings müssten dann auch die Kontrollen deutlich konsequenter ablaufen und Verstösse mit entsprechend drastischen Sanktionen belegt werden. Etwas was unter Umständen für Deutschland, aber leider kaum für die traditionell konfliktscheue Schweiz vorstellbar ist. Wenn die Verantwortlichen nicht kurzfristig und drastisch reagieren, müssen wir davon ausgehen, dass wir der Ärzteschaft und den Pflegenden die fürchterliche Triage, Entscheidungen über Chance auf Leben und Tod, mit unserem Verhalten zumuten werden. Was das mit der Psyche der vor Ort handelnden Personen macht und für langfristige Folgen auf die Motivation zur Arbeit mit Schwerkranken haben wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Die Tatsache das Deutschland diesen Winter aufgrund der Kündigungen von Pflegekräften rund 20% weniger Intensivpflegebetten zur Verfügung hat, deutet diesbezüglich auf eine schlimme Entwicklung hin, welche uns alle auch noch lange nach Corona beschäftigen wird. Vielleicht ist es jetzt doch Zeit, über eine allgemeine Impfpflicht oder zumindest deutlich stärkere Einschränkungen für Impfunwillige nachzudenken. Österreich mit der anstehenden allgemeinen Impfpflicht und Singapur, mit der Weigerung der Kostenübernahme für Covid-Behandlungen bei Ungeimpften, geben uns dafür praktikable und nachahmenswerte Beispiele. Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte im Krankheits- und Quarantänefall könnten wegfallen und noch einiges mehr. Vorschläge gebe es zur Genüge. Konflikte werden sich nicht vermeiden lassen. Vielleicht wird es sogar Zeit diese endlich durchzustehen und rational hinter uns zu bringen - gemeinsam. Quellen https://projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020/web/summary/54-55/ https://projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020/files/COSMO_W55_Quali.pdf https://projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020/archiv/16-01/cosmo-analysis.html#3_psychologische_lage von David Schmidt Weltweit leben 2.8 Millionen Menschen mit Multipler Sklerose (MS). In Deutschland sind ca. 252 000, in der Schweiz ca. 15 200 und in Österreich ungefähr 13 500 Patient:innen davon betroffen. Diese Patientengruppe setzt sich aus in etwa 69% Frauen und 31% Männern zusammen. Die MS gilt dabei als die häufigste, zur Behinderung führende, neurologische Erkrankung bei jungen Menschen (MS International Federation / Atlas of MS, 2020).
Patient:innen die an MS leiden, haben bekanntlich diverse Symptome. Nicht ohne Grund wird die MS (übersetzt: „vielfach harte Narben“) auch als Erkrankung der „tausend Gesichter“ bezeichnet (DMSG, 2021). Die Symptome, als Folge der autoimmunen Entzündungsvorgänge bzw. des langfristigen Abbaus der Isolierschicht der Nervenbahnen, des Myelins, und der Axone im zentralen und peripheren Nervensystem, können sich unteranderem als Magen-Darmbeschwerden, Blasenstörungen, Missempfindungen an den Extremitäten, Spastiken, Muskelschwäche, unspezifische Schmerzen, Gleichgewichtsprobleme, Sehstörungen, kognitive Beschwerden/Einschränkungen, Gangunsicherheiten bzw. unsichere Bewegungen (Tremor, Ataxie), Depressionen und viele weitere Symptome zeigen. Laut Zajicek et al. (2010) ist die Fatigue mit 80% das häufigste Symptom, und gemäss Wynia et al. (2008) das „schwächendste Symptom der Multiplen Sklerose“. Rottoli et al. (2016) sagen, dass die Fatigue für 55% der Patient:innen das störendste Symptom im Rahmen ihrer Erkrankung sei. Wie zeigt sich Fatigue bei MS? Die Fatigue beschreibt erst einmal „nur“ eine starke subjektive körperliche und mentale Erschöpfung, welche die Erkrankten regelmässig dazu zwingt, Pausen einzulegen und im schlimmsten Fall zur Arbeitsunfähigkeit führen kann (DMSG, 2021). Mills und Young definierten 2007 die Fatigue bei Multipler Sklerose als, „reversible, motorische und kognitive Beeinträchtigung mit reduzierter Motivation und erhöhtem Ruhebedürfnis, die entweder spontan auftreten oder durch geistige oder körperliche Aktivität, hohe Luftfeuchtigkeit, akute Infektionen und Nahrungsaufnahme hervorgerufen werden. Die Fatigue kann jederzeit auftreten, ist aber in der Regel nachmittags schlimmer. Bei MS kann Fatigue täglich auftreten, besteht in der Regel seit Jahren und ist schwerer als jede prämorbide Fatigue.“ Welche Symptome zeigt die Fatigue? Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bundesverband (2021) benennt die folgenden Symptome bei der MS-Fatigue: - Antriebs- und Energiemangel - Dauerhaft vorhandenes Müdigkeitsgefühl mit Auswirkung auf die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit - Wärme verstärkt die Fatigue - Viele Patient:innen klagen täglich über die Symptome - Meist hält die Erschöpfung/Müdigkeit mehr als 6 Stunden am Tag an - Die Beschwerden verstärken sich meist zum Abend hin - Rückzug aus dem sozialen Umfeld - In einzelnen Fällen eine frühzeitige Bereitung Wie wird die Fatigue unterteilt? Rottoli et al. (2016) unterteilt sie in eine primäre und eine sekundäre Fatigue. Bei der primären Form ist die Fatigue spezifisch für die MS, wenn keine anderen erkennbaren Ursachen vorhanden seien. Bei der sekundären Art, entsteht diese als Folge anderer Beschwerden bzw. Komorbiditäten im Rahmen der MS. Die Mechanismen der sekundären Fatigue für die einzelnen anderen Symptome aufzugleisen, sprengt leider den Rahmen dieses Blogs. Schauen wir uns daher die primäre Form etwas genauer an: Bei der primären Fatigue ist die dahinter stehende Pathophysiologie hochkomplex und noch nicht ganz verstanden. Es zeigen sich allerdings einige hochinteressante und spannende Besonderheiten und Veränderungen im Labor, wie auch bei funktionellen MRT-Aufnahmen des zentralen Nervensystems bei betroffenen Patient:innen. Es werden in der Literatur periphere und zentrale Mechanismen genannt und diskutiert, die sehr wahrscheinlich die primäre Fatigue bei MS beeinflussen. Anomalien im zentralen Nervensystem stehen besonders in Verdacht, die pathophysiologischen Vorgänge massgeblich mit zu beeinflussen. Besonders die Frontalregion zeigte in mehreren neurophysiologischen Studien eine gesteigerte Aktivität, während der Vorbereitung und Ausführung von motorischen Aktionen bei Patient:innen mit Fatigue, im Vergleich zu Betroffenen ohne Fatigue (Leocani et al., 2001; Thickbroom et al., 2006; Perretti et al., 2004; Liefert et al., 2005). Funktionelle FDG-PET-Scan Aufnahmen (Hallo Science-Nerds! Übersetzung: Fluordeoxyglucose-Positronen-Emissions-Tomographie) geben klare Hinweise darauf, dass Fatigue als ein zentraler Punkt bei MS anzuerkennen ist. Bei Patient:innen mit einer primären Fatigue kommt es zu einer deutlichen Abnahme der Stoffwechselvorgänge im medialen und lateralen präfrontalen Kortex, des prämotorischen Kortex und des Putamen, sowie des rechten ergänzenden motorischen Bereichs (Roelcke et al., 1997). Des Weiteren zeigen diese Spezialaufnahmen, dass Patient:innen mit MS und einer Fatigue schon bei einfachen motorischen Aufgaben eine geringere Aktivität der kontralateralen sensomotorischen kortikalen Bereiche und des Thalamus aufweisen. Die Forscher vermuten, basierend auf diesen Aufnahmen von Filippi et al. (2002), pathophysiologische Zusammenhänge zwischen einer Unterbrechung des kortiko-subkortikalen Kreislaufs und der Fatigue, bei gleichzeitig läsionsbedingt abnormaler Rekrutierung frontothalamischer Leitungsbahnen. Die bei einigen MS-Patient:innen bereits früh, durch MR-Spektroskopien, nachweisbaren axonalen Dysfunktionen bestätigen diese Theorie (Tartaglia et al., 2004; Derache et al., 2013). Weitere, der modernen Radiologie zu verdankende Erkenntnisse, beziehen sich auf die graue und weisse Masse bei an Fatigue leidenden MS-Patient:innen, im Vergleich zu Gesunden und „fatigue-freien“ MS-Patient:innen. Sie fanden signifikante Atrophien im Bereich des rechten Nucleus accumbens (Teil des dopaminergen Kreislaufs von präfrontaler Kortex, Amygdala und zentralem Pallidum). Dieser Teil des Gehirns ist vor allem für die Steuerung von Motivation und Belohnung verantwortlich (Rocca et al., 2014; Salamone et al., 2007). Dopaminmangel steht im Verdacht, an der Entwicklung einer primären Fatigue beteiligt zu sein. Die weiteren krankheitstypischen zentralen Entzündungsprozesse, mit ihren MS-typischen Läsionen, in den Bereichen des Thalamus, der Basalganglien und des frontalen Kortex scheinen ursächlichen Einfluss auf die primäre zentrale Fatigue zu haben (Leocani et al., 2008). In Laboruntersuchungen konnten Hessen et al. 2006 nachweisen, dass Patient:innen mit einer MS-Fatigue deutlich höhere Werte von Interferon (IFN) Gamma und Tumornekrosefaktor Alpha aufwiesen, als Patient:innen mit MS ohne Fatigue (Heesen, 2006). Interleukin 6 konnte dagegen nicht als entscheidender Faktor bei der Fatigue bestätigt werden. Zwar sind die Konzentrationen, vor allem bei Rezidiven, erhöht, allerdings schwanken die Werte zu stark, als das eine belastbare Verbindung hergestellt werden kann. Weitere hochinteressante Erkenntnisse aus den Forschungslaboren zeigen den Einfluss von oxidativem Stress auf die menschlichen Zellen. Bei MS-Patient:innen, insbesondere bei Frauen, mit Fatigue zeigten sich, einerseits erhöhte Homocysteinspiegel und, daraus resultierend, eine erhöhte Lipidperoxidation (Tomic et al., 2012). Bei diesem chemischen Prozess werden freie Radikale aus Lipiden gebildet. Wenn die Möglichkeiten des endogenen Antioxidanssystems überstiegen werden, setzt sich eine hochpathologische Kettenreaktion in Gang und die freien Fettsäureradikale schädigen die Zellmembranen. Die Folgen dieses oxidativen Stresses können zu einer Inaktivierung der Natrium-Kalium-Pumpe, welche entscheidend für die Muskulatur ist, und zu Dysfunktionen unserer Kraftwerke der Zellen, den Mitochondrien, führen. Diese pathologischen Vorgänge können eine Erklärung für die periphere und zentrale Erschöpfung sein und des Weiteren zu Schäden im zentralen Nervensystem führen (Dudman et al, 1993; Morris et al, 2015). Einen weiteren möglichen Grund für die primäre Fatigue führen Tellez und Kollegen (2006) an. Sie stellen die im Labor gefundenen niedrigen Serumspiegel von Dehydroepiandrosteron, ähnlich wie beim chronischen Müdigkeitssyndrom, in Verbindung zur anhalten Erschöpfung bei MS-Patient:innen. Einen letzten Unterschied fanden ein Jahr zu vor, 2005, Gottschalk et al. in einer Fehlregulation in der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse. Sie konnten zeigen, dass MS-Patient:innen mit einer Fatigue signifikant höhere adrenokortikotrope Hormonspiegel, verglichen mit „fatigue-freien“ MS-Patient:innen aufwiesen. Wie kann ich die Fatigue bei meinen Patient:innen bewerten? Die meisten Studien verwendeten entweder die FSS (Fatigue Severity Scale) oder MFIS (Modified Fatigue Impact Scale) als Instrumente zur Fatiguebewertung. Die neun Fragen des FSS messen und vergleichen die Intensität der Fatigue mit der funktionellen Beeinträchtigung. (Mills et al., 2009) Das MFIS hat sich bei der Bewertung kognitiver und körperlicher Aspekte von Erschöpfung als wertvoll erwiesen, jedoch nicht bei der allgemeinen Müdigkeit (Mills et al., 2010). Dieser Test kann die Teilbereiche „physisch“, „kognitiv“ und „psycho-sozial“ einzeln bewerten, welche dafür aber in ihren Ergebnissen sehr stark miteinander korrelieren. Ob die Unterteilung dann noch Sinn macht, ist etwas fraglich. Laut Learmonth et al. (2013) und Rietberg et al. (2010) sind der FSS und MFIS in ihren Aussagen vergleichbar. Einzig bei Elbers et al. (2011) ist der validierte FSMC (Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions) bei Menschen mit MS empfindlicher und spezifischer als vergleichbare Assessments. Diese Skala diene der Abschätzung der Schwere der kognitiven und motorischen Auswirkungen durch MS-induzierte Fatigue und sei sehr spezifisch und sensitiv. Wichtiger Hinweis unsererseits: Bitte beachtet bei diesen Assessments, dass die Urheberrechte gewahrt bleiben und die Nutzung der Fragebögen mitunter kostenpflichtig sein kann. Bitte informiert Euch unbedingt vor deren Nutzung! Vielen Dank! Welche Therapie wird empfohlen? Beginnen wir mit der sekundären Form der Fatigue: Hier ist es entscheidend, die Fatigue auslösende bzw. -verstärkende Ursache zu behandeln. Bei Spastiken, Neuralgien oder muskuloskelettalen Beschwerden werden häufig Medikamente, wie z.B. Amantadine, Modafinil oder Pemoline, verabreicht. Deren Wirksamkeit wird allerdings von einigen Studien in Frage gestellt. Zwar scheinen die Mittel besser als Placebos zu wirken, die klinische Signifikanz ist aber nicht final geklärt. Des Weiteren sind die Nebenwirkungen nicht zu unterschätzen und ähneln MS-typischen Krankheitssymptomen (Asano & Finlayson, 2014; Branas et al., 2000; Stankoff et al., 2005; Möller et al., 2011; Mücke et al., 2015). Physiotherapie kann bei den genannten Schmerzproblematiken helfen (Rottoli et al., 2016). Andere Beschwerden, wie Depressionen, Schlafproblematiken oder andere psychische Erkrankungen, werden mit Entspannungstechniken und psychotherapeutischen Therapieformen wie der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt. Bei Knoop et al. (2011) zeigten sich diesbezüglich positive Effekte. Die Physiotherapie kann laut Rottoli et al. (2016) wie bei den beschriebenen Schmerzproblematiken auch hier unterstützend wirken. Nebenwirkungen von Medikamenten können ebenfalls Einfluss auf eine sekundäre Fatigue bei MS nehmen und müssen zwingend ärztlich behandelt werden. Wir Physiotherapeut:innen sollten uns mit diesbezüglichen Empfehlungen zurückhalten und wie der Schuster bei seinen Leisten bleiben. Als therapeutische Optionen bei der primären Fatigue zeigten sich laut Heine et al. (2015) Vorteile beim Ausdauertraining, bei Yoga und Gleichgewichtstraining. Krafttraining und aufgabenorientiertes Training zeigten dagegen keine signifikanten Effekte. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die Studienqualitäten maximal moderater Qualität und nicht gleichmässig repräsentiert waren, in kleinen Gruppen durchgeführt und, speziell das Kraft- und ADL-Training, nur mit wenigen Studien untersucht wurden. Andere Studien, wie die Literaturrecherchen von Andreasen et al. (2011) und Kjolhede et al. (2012) zeigten hingegen positive Ergebnisse in Bezug auf Krafttraining bei Fatigue. Aufgrund des weithin bekannten Benefits von Krafttraining bei MS, sollte dieses ein fester Bestandteil des Trainingsprogramms der Patient:innen sein und auch langfristig bleiben. Heine et al. (2015) nennt drei dominierende Hypothesen, warum Training bei einer MS-Fatigue wirken könnte: 1. Ausdauertraining verbessert die Energiereserven bzw. Ausdauerfähigkeit, welche im Gegenzug eventuell einen positiven Einfluss auf die Fatigue hat (Andreasen et al., 2011). 2. Bewegungstherapie kann neuroprotektive Mechanismen induzieren, die langfristige Behinderungen reduzieren (White und Castellano, 2008a; White und Castellano, 2008b). 3. Drittens kann Bewegungstherapie die Deregulierung der HPA-Achse normalisieren (Gottschalk et al., 2005). Diese Hypothesen beruhen weitgehend auf der Annahme, dass die tatsächliche Bewegungstherapie von ausreichender Dauer, Dosis und Intensität ist, um solche Veränderungen herbeizuführen. Generelle Empfehlungen für Bewegung vom American College of Sports Medicine: Es empfiehlt Erwachsenen, an fünf oder mehr Tagen pro Woche ein Herz-Kreislauf-Training mit mittlerer Intensität während 30 Minuten zu absolvieren, insgesamt 150 Minuten oder länger pro Woche. Alternativ kann auch ein Herz-Kreislauf-Training mit kräftiger Intensität während 20 Minuten oder länger pro Tag an drei oder mehr Tagen pro Woche (75 Minuten oder länger pro Woche) oder eine Kombination aus mässiger und kräftiger Intensität (Garber et al., 2011) durchgeführt werden. In den Arbeiten von Andreasen et al. (2011) und Kjolhede et al.(2012), welche positive Resultate für das Krafttraining gezeigt haben, waren die Trainingsparameter wie folgt: Andreasen et al. (2011): Drei inkludierte Studien, welche sich mit Krafttraining beschäftigten, haben mit ihren Teilnehmern wie folgt trainiert: 1. Über 4 Wochen zweimal pro Woche zwei Sätze mit 10-12 RM (Wiederholungsmaximum) bei drei Übungen für die untere und obere Extremität; 2. Über 8 Wochen zweimal pro Woche an fünf Geräten für die untere Extremität. 1. Woche: Ein Satz mit 6-10 Wiederholungen bei 50% MVC (maximale freiwillige Kontraktion). 2.-8. Woche: Ein Satz mit 10-15 Wiederholungen. Intensität in der zweiten Woche: 60% MVC und von der dritten bis achten Woche: 70%. Wenn 15 Wiederholungen erreicht wurden, konnte das Gewicht um 2-5% erhöht werden. 3. Über 12 Wochen zweimal die Woche an fünf Geräten für die untere Extremität. 1.-2. Woche: Drei Sätze mit 10 Wiederholungen bei 15 RM. 3.-4. Woche: Drei Sätze mit 12 Wiederholungen bei 12 RM. 5.-6. Woche vier Sätze mit 12 Wiederholungen bei 12 RM. 7.-8. Woche vier Sätze mit 10 Wiederholungen bei 10 RM. 9.-10. Woche vier Sätze mit 8 Wiederholungen bei 8 RM. 11.-12. Woche drei Sätze mit 8 Wiederholungen bei 8 RM. Kjolhede (2012) et al.: 1. Über 8 Wochen zweimal die Woche mit acht Übungen und 2-3 Sätzen mit 6-10 Wiederholungen. Bei dieser kleinen Studie war die Drop-out-Rate mit 24% sehr hoch und auf der PEDro-Skala nur mit 4/10 bewertet. 2. Die zweite und dritte von Kjolhede untersuchten Arbeiten, waren die ebenfalls von Andreasen et al. genutzten Arbeiten, welche hier oben an erster und dritter Stelle wiedergegeben werden. Insgesamt ist leider zu sagen, dass die Aussagen zwar physio- und trainingstherapeutisch vielversprechend sind, zu diesem Thema aber viel zu wenige qualitativ hochwertige Studien existieren. Bitte beachtet beim Training folgende Punkte: Die Trainingsbedingungen sollten auf MS-Patient:innen ausgerichtet sein.
Wie lange hält der Trainingseffekt an und was müssen unsere Patient:innen wissen? Wenn das Training gestoppt wird, hält der erreichte Effekt leider nicht lange an. Keine der Studien mit einer Nachbeobachtungsphase, zeigten im Anschluss eine Verringerung der Ermüdung in der Trainingsgruppe, verglichen mit der Kontrollgruppe. Bestenfalls wurden die festgestellten Fatigue-Unterschiede beibehalten. Daher sollte sich bei MS die Therapie hin zu dauerhaft den Lebensstil verändernden Interventionen entwickeln (Motl & Gosney, 2008). Das heisst, die Patient:innen müssen ihr intensives Training langfristig beibehalten und zu einem aktiveren und gesünderen Lebensstil wechseln, um ihren Zustand zu stabilisieren und bestenfalls zu verbessern. Kognitive Verhaltenstherapie, evtl. Medikamentenumstellungen und Physiotherapie bieten sich als weitere Optionen im individuellen Therapieprogramm. Vielen Dank für Euer Interesse und viel Erfolg bei der Umsetzung! Literatur 1. Andreasen, A., Stenager, E. & Dalgas, U. (2011). The effect of exercise therapy on fatigue in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 17(9), 1041–1054. https://doi.org/10.1177/1352458511401120 2. Asano, M. & Finlayson, M. L. (2014). Meta-Analysis of Three Different Types of Fatigue Management Interventions for People with Multiple Sclerosis: Exercise, Education, and Medication. Multiple Sclerosis International, 2014, 1–12. https://doi.org/10.1155/2014/798285 3. Brañas, Jordan, Fry-Smith, Burls & Hyde. (2000). Treatments for fatigue in multiple sclerosis: a rapid and systematic review. Health Technology Assessment, 4(27). https://doi.org/10.3310/hta4270 4. Derache, N., Grassiot, B., Mézenge, F., Emmanuelle Dugué, A., Desgranges, B., Constans, J. M. & Defer, G. L. (2013). Fatigue is associated with metabolic and density alterations of cortical and deep gray matter in Relapsing-Remitting-Multiple Sclerosis patients at the earlier stage of the disease: A PET/MR study. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2(4), 362–369. https://doi.org/10.1016/j.msard.2013.03.005 5. Dudman, N. P., Wilcken, D. E. & Stocker, R. (1993). Circulating lipid hydroperoxide levels in human hyperhomocysteinemia. Relevance to development of arteriosclerosis. Arteriosclerosis and Thrombosis: A Journal of Vascular Biology, 13(4), 512–516. https://doi.org/10.1161/01.atv.13.4.512 6. Elbers, R. G., Rietberg, M. B., van Wegen, E. E. H., Verhoef, J., Kramer, S. F., Terwee, C. B. & Kwakkel, G. (2011). Self-report fatigue questionnaires in multiple sclerosis, Parkinson’s disease and stroke: a systematic review of measurement properties. Quality of Life Research, 21(6), 925–944. https://doi.org/10.1007/s11136-011-0009-2 7. Fatigue. (2021, 6. August). DMSG - Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bundesverband e.V. https://www.dmsg.de/multiple-sklerose-infos/ms-behandeln/symptomatische-therapie/fatigue/ 8. Filippi, M., Rocca, M., Colombo, B., Falini, A., Codella, M., Scotti, G. & Comi, G. (2002). Functional Magnetic Resonance Imaging Correlates of Fatigue in Multiple Sclerosis. NeuroImage, 15(3), 559–567. https://doi.org/10.1006/nimg.2001.1011 9. Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I. M., Nieman, D. C. & Swain, D. P. (2011). Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(7), 1334–1359. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e318213fefb 10. Gottschalk, M., Kümpfel, T., Flachenecker, P., Uhr, M., Trenkwalder, C., Holsboer, F. & Weber, F. (2005). Fatigue and Regulation of the Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis in Multiple Sclerosis. Archives of Neurology, 62(2), 277. https://doi.org/10.1001/archneur.62.2.277 11. Heesen, C. (2006). Fatigue in multiple sclerosis: an example of cytokine mediated sickness behaviour? Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 77(1), 34–39. https://doi.org/10.1136/jnnp.2005.065805 12. Heine, M., van de Port, I., Rietberg, M. B., van Wegen, E. E. & Kwakkel, G. (2015). Exercise therapy for fatigue in multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews. Published. https://doi.org/10.1002/14651858.cd009956.pub2 13. Kjølhede, T., Vissing, K. & Dalgas, U. (2012). Multiple sclerosis and progressive resistance training: a systematic review. Multiple Sclerosis Journal, 18(9), 1215–1228. https://doi.org/10.1177/1352458512437418 14. Knoop, H., van Kessel, K. & Moss-Morris, R. (2011). Which cognitions and behaviours mediate the positive effect of cognitive behavioural therapy on fatigue in patients with multiple sclerosis? Psychological Medicine, 42(1), 205–213. https://doi.org/10.1017/s0033291711000924 15. Learmonth, Y., Dlugonski, D., Pilutti, L., Sandroff, B., Klaren, R. & Motl, R. (2013). Psychometric properties of the Fatigue Severity Scale and the Modified Fatigue Impact Scale. Journal of the Neurological Sciences, 331(1–2), 102–107. https://doi.org/10.1016/j.jns.2013.05.023 16. Leavitt, V. M., de Meo, E., Riccitelli, G., Rocca, M. A., Comi, G., Filippi, M. & Sumowski, J. F. (2015). Elevated body temperature is linked to fatigue in an Italian sample of relapsing–remitting multiple sclerosis patients. Journal of Neurology, 262(11), 2440–2442. https://doi.org/10.1007/s00415-015-7863-8 17. Leocani, L., Colombo, B., Magnani, G., Martinelli-Boneschi, F., Cursi, M., Rossi, P., Martinelli, V. & Comi, G. (2001). Fatigue in Multiple Sclerosis Is Associated with Abnormal Cortical Activation to Voluntary Movement—EEG Evidence. NeuroImage, 13(6), 1186–1192. https://doi.org/10.1006/nimg.2001.0759 18. Leocani, L., Colombo, B. & Comi, G. (2008). Physiopathology of fatigue in Multiple Sclerosis. Neurological Sciences, 29(S2), 241–243. https://doi.org/10.1007/s10072-008-0950-1 19. Liepert, J., Mingers, D., Heesen, C., Bäumer, T. & Weiller, C. (2005). Motor cortex excitability and fatigue in multiple sclerosis: a transcranial magnetic stimulation study. Multiple Sclerosis Journal, 11(3), 316–321. https://doi.org/10.1191/1352458505ms1163oa 20. Malkki, H. (2016). Dehydration might contribute to fatigue in MS. Nature Reviews Neurology, 12(10), 555. https://doi.org/10.1038/nrneurol.2016.139 21. Mills, R. & Young, C. (2007). A medical definition of fatigue in multiple sclerosis. QJM, 101(1), 49–60. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcm122 22. Mills, R., Young, C., Nicholas, R., Pallant, J. & Tennant, A. (2009). Rasch analysis of the Fatigue Severity Scale in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 15(1), 81–87. https://doi.org/10.1177/1352458508096215 23. Mills, R. J., Young, C. A., Pallant, J. F. & Tennant, A. (2010). Rasch analysis of the Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) in multiple sclerosis. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(9), 1049–1051. https://doi.org/10.1136/jnnp.2008.151340 24. Möller, F., Poettgen, J., Broemel, F., Neuhaus, A., Daumer, M. & Heesen, C. (2011). HAGIL (Hamburg Vigil Study): a randomized placebo-controlled double-blind study with modafinil for treatment of fatigue in patients with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 17(8), 1002–1009. https://doi.org/10.1177/1352458511402410 25. Motl, R. & Gosney, J. (2008). Effect of exercise training on quality of life in multiple sclerosis: a meta-analysis. Multiple Sclerosis Journal, 14(1), 129–135. https://doi.org/10.1177/1352458507080464 26. Morris, G., Berk, M., Galecki, P., Walder, K. & Maes, M. (2015). The Neuro-Immune Pathophysiology of Central and Peripheral Fatigue in Systemic Immune-Inflammatory and Neuro-Immune Diseases. Molecular Neurobiology, 53(2), 1195–1219. https://doi.org/10.1007/s12035-015-9090-9 27. Multiple Sklerose - auf den Spuren der 1000 Gesichter - Was ist MS?: Multiple Sklerose - Jugend und MS (Multiple Sklerose) - DMSG e.V. DMSG Bundesverband e.V. 21.08.2021. https://www.dmsg.de/jugend-und-ms/multiple-sklerose/index.php?w3pid=wasistms&kategorie=multiplesklerose 28. Mücke, M., Mochamat, M., Cuhls, H., Peuckmann-Post, V., Minton, O., Stone, P. & Radbruch, L. (2015). Pharmacological treatments for fatigue associated with palliative care. Cochrane Database of Systematic Reviews. Published. https://doi.org/10.1002/14651858.cd006788.pub3 29. Noronha, M. J., Vas, C. J. & Aziz, H. (1968). Autonomic dysfunction (sweating responses) in multiple sclerosis. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 31(1), 19–22. https://doi.org/10.1136/jnnp.31.1.19 30. Number of people with MS | Atlas of MS. (2020). Atlasofms.Org. https://www.atlasofms.org/map/global/epidemiology/number-of-people-with-ms 31. Perretti, A., Balbi, P., Orefice, G., Trojano, L., Marcantonio, L., Brescia-Morra, V., Ascione, S., Manganelli, F., Conte, G. & Santoro, L. (2004). Post-exercise facilitation and depression of motor evoked potentials to transcranial magnetic stimulation: a study in multiple sclerosis. Clinical Neurophysiology, 115(9), 2128–2133. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2004.03.028 32. Rietberg, M. B., van Wegen, E. E. H. & Kwakkel, G. (2010). Measuring fatigue in patients with multiple sclerosis: reproducibility, responsiveness and concurrent validity of three Dutch self-report questionnaires. Disability and Rehabilitation, 32(22), 1870–1876. https://doi.org/10.3109/09638281003734458White, L. J. & Castellano, V. (2008). Exercise and Brain Health – Implications for Multiple Sclerosis. Sports Medicine, 38(3), 179–186. https://doi.org/10.2165/00007256-200838030-00001 33. Rocca, M. A., Parisi, L., Pagani, E., Copetti, M., Rodegher, M., Colombo, B., Comi, G., Falini, A. & Filippi, M. (2014). Regional but Not Global Brain Damage Contributes to Fatigue in Multiple Sclerosis. Radiology, 273(2), 511–520. https://doi.org/10.1148/radiol.14140417 34. Roelcke, U., Kappos, L., Lechner-Scott, J., Brunnschweiler, H., Huber, S., Ammann, W., Plohmann, A., Dellas, S., Maguire, R. P., Missimer, J., Radii, E. W., Steck, A. & Leenders, K. L. (1997). Reduced glucose metabolism in the frontal cortex and basal ganglia of multiple sclerosis patients with fatigue. Neurology, 48(6), 1566–1571. https://doi.org/10.1212/wnl.48.6.1566 35. Rottoli, M., La Gioia, S., Frigeni, B. & Barcella, V. (2016). Pathophysiology, assessment and management of multiple sclerosis fatigue: an update. Expert Review of Neurotherapeutics, 17(4), 373–379. https://doi.org/10.1080/14737175.2017.1247695 36. Stankoff, B., Waubant, E., Confavreux, C., Edan, G., Debouverie, M., Rumbach, L., Moreau, T., Pelletier, J., Lubetzki, C. & Clanet, M. (2005). Modafinil for fatigue in MS: A randomized placebo-controlled double-blind study. Neurology, 64(7), 1139–1143. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000158272.27070.6a 37. Tartaglia, M. C., Narayanan, S., Francis, S. J., Santos, A. C., de Stefano, N., Lapierre, Y. & Arnold, D. L. (2004). The Relationship Between Diffuse Axonal Damage and Fatigue in Multiple Sclerosis. Archives of Neurology, 61(2), 201. https://doi.org/10.1001/archneur.61.2.201 38. Téllez, N., Comabella, M., Julià, E. V., Río, J., Tintoré, M. A., Brieva, L., Nos, C. & Montalban, X. (2006). Fatigue in progressive multiple sclerosis is associated with low levels of dehydroepiandrosterone. Multiple Sclerosis Journal, 12(4), 487–494. https://doi.org/10.1191/135248505ms1322oa 39. Thickbroom, G. W., Sacco, P., Kermode, A. G., Archer, S. A., Byrnes, M. L., Guilfoyle, A. & Mastaglia, F. L. (2006). Central motor drive and perception of effort during fatigue in multiple sclerosis. Journal of Neurology, 253(8), 1048–1053. https://doi.org/10.1007/s00415-006-0159-2 40. Tomic, S., Brkic, S., Maric, D. & Mikic, A. N. (2012b). Lipid and protein oxidation in female patients with chronic fatigue syndrome. Archives of Medical Science, 5, 886–891. https://doi.org/10.5114/aoms.2012.31620 41. White, L. J. & Castellano, V. (2008b). Exercise and Brain Health – Implications for Multiple Sclerosis. Sports Medicine, 38(3), 179–186. https://doi.org/10.2165/00007256-200838030-00001 42. Wynia, K., Middel, B., van Dijk, J., de Keyser, J. & Reijneveld, S. (2008). The impact of disabilities on quality of life in people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 14(7), 972–980. https://doi.org/10.1177/1352458508091260 43. Zajicek, J. P., Ingram, W. M., Vickery, J., Creanor, S., Wright, D. E. & Hobart, J. C. (2010). Patient-orientated longitudinal study of multiple sclerosis in south west England (The South West Impact of Multiple Sclerosis Project, SWIMS) 1: protocol and baseline characteristics of cohort. BMC Neurology, 10(1). https://doi.org/10.1186/1471-2377-10-88 von David Schmidt An Krebs erkrankte bzw. den Krebs besiegende Patient*innen sind mittlerweile fester Bestandteil im gesellschaftlichen und physiotherapeutischen Alltag. Einerseits werden wir immer älter und damit steigt auch unser Risiko zu erkranken, andererseits hat vor allem die Medizin in den letzten Jahrzehnten dermassen grosse Fortschritte gemacht, dass immer mehr Mitmenschen den Krebs über- bzw. zumindest länger damit leben können. Laut den Daten des Robert-Koch-Institutes erkrankten 2017 ca. 489´000 Menschen in Deutschland an Krebs. Davon wurde bei ca. 259'000 Männern und bei 230'000 Frauen die Diagnose Krebs gestellt. Etwa die Hälfte der Fälle betrafen die Brustdrüse (67'900), Prostata (62'200), Dickdarm (58'900) und die Lunge (57'500).
Laut Statistik des RKI leben nach 5 Jahren noch 65% der Frauen und 59% der Männer. Nach 10 Jahren weilen noch 61% der Frauen und 54% der Männer unter uns. Die Prävalenz nimmt seit Jahren zu und damit kommen auch wir Physiotherapeut*innen immer mehr ins Spiel. Warum das so ist? Onkologische Patienten können vielfältige Beschwerden haben. Neben den verschiedensten „ganz normalen“ muskuloskelettalen Gebrechen, können sie beispielsweise über operationsbedingte Kontinenz-Problematiken klagen, an medikamenteninduzierten Polyneuropathien leiden, oder mit Bewegungseinschränkungen der Schulter nach Mamma-Ca kämpfen - und vielem mehr. Was der Grossteil unserer Patient*innen gemein hat: 60-90% aller Krebserkrankten sind von Fatigue, dem sogenannten Erschöpfungssyndrom, betroffen. Bei 30-60% dieser Patient*innen wird diese Erschöpfung als mittlere bis schwere Form eingestuft. (Bower 2014; Pachman et al. 2012) Als Fatigue wird der teils extreme Erschöpfungszustand bezeichnet, den Patient*innen oftmals als Nebeneffekt der Krebstherapie erleben. Dabei handelt es sich um viel mehr als nur starke Müdigkeit. Dieser Zustand schränkt durch die starke Erschöpfung die Belastbarkeit und die Ausübung von Alltagsaktivitäten der betroffenen Personen massiv ein. (McNeely et al. 2010). Was passiert bei der Fatigue physiologisch? Die Ursache für die krebsbehandlungsassoziierte Fatigue ist auf molekularer Ebene noch immer nicht ganz geklärt. (Bower 2014; Wood et al. 2009). Was man weiss ist, dass bei dieser Form der Fatigue die Produktion der proinflammatorischen Zytokine Interleukin-1 Beta (IL-1β) sowie des Tumornekrosefaktor Alpha (TNF-α) initiiert wird und dieser Prozess sehr erfolgreich mit körperlichem Training bekämpft werden kann. Der vermutete Mechanismus hinter dem Erfolg von körperlichem Training zur Bekämpfung von Fatigue, dürfte die Absonderung des Interleukin-6 (IL-6) aus dem pathogenen Umfeld der Makrophagen sein. Dem IL-6 wird in diesem Setting eine zentrale Rolle in der Immunantwort auf eine Sepsis zugeschrieben. Bei körperlichem Training hingegen, wird es selektiv aus der Muskelzelle ausgeschüttet (Pedersen und Febbraio, 2008). Im Trainingsumfeld entfaltet IL-6 über die Herunterregulierung und Deaktivierung von IL-1β sowie TNF-α eine antiinflammatorische Wirkung (Wood et al. 2009). Das würde erklären, warum Trainingsinterventionsstudien durchwegs eine Verbesserung der Fatigue bei Krebspatienten aufzeigen (Meneses-Echávez et al., 2015). Was sind typische Fatigue-Symptome? Moss-Morris (2010) benennt die folgenden Beschwerden bei krebsinduzierter Fatigue als symptomatisch:
Welche Assessments bieten sich an? Es stehen Gesundheitsfachpersonen verschiedene Fragebögen zur Ermittlung des Ist-Zustandes bei Fatigue zur Verfügung. Mit dem speziell auf onkologische Patient*innen zugeschnittenen FACT-F (Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue) können Details zum Erschöpfungssyndrom erfragt werden. Für anderweitig chronisch Kranke kann der FACIT-F (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue) genutzt werden. (Yellen et al, 1997; Lai et al, 2003). Hier der Link zum FACT-F. Der komplette FACIT-F-Fragebogen besteht aus 41 Fragen aus fünf Bereichen. Es werden die Kategorien „Körperliches“, „Soziales“, „Emotionales“ und „Funktionelles“ Wohlbefinden erfragt. Das Erschöpfungssyndrom wird mittels einer Subskala erhoben. Der FACIT-F/ FACT-F ist zum selbstständigen Ausfüllen durch Patient*innen entwickelt worden, kann aber auch von einem Therapeuten oder einer Therapeutin abgefragt werden (Link zum FACIT-F). Ebenfalls für die Erfassung des Erschöpfungssyndroms gibt es das Modul QLQ-FA12 des EORTC QLQ-C30 (Seyidova-Khoshknabi et al., 2010). Hier der Link zum validen, aber eher aufwändigen Fragebogen Spezifisch für das Assessment von Fatigue bei Krebspatient*innen ist der Brief Fatigue Inventory (BFI) vom MD Anderson Cancer Center, Texas, USA, entwickelt worden (Seyidova-Khoshknabi et al., 2010; Mendoza et al., 1999). Er umfasst die Beurteilung einerseits der aktuellen und andererseits der schlimmsten Erschöpfung in den letzten 24 Stunden (Mendoza et al., 1999). Hier der Link zum Brief Fatigue Inventory. Bitte beachtet, dass die Fragebögen zum Teil kostenpflichtig sind bzw. nur nach Genehmigung benutzt werden dürfen. Informiert Euch sicherheitshalber vorher bei den verlinkten Anbietern. Was sind unsere Therapieoptionen? Die folgenden Grundsätze zum allgemeinen Training, Kraft- und Ausdauertraining werden von der Onkologischen Trainings- und Bewegungstherapie (OTT) der Uniklinik Köln empfohlen:
Empfehlung und Therapieschwerpunkte beim Krafttraining:
Empfehlung und Therapieschwerpunkte beim Ausdauertraining:
Im Idealfall arbeitet man bei der Planung des Trainingsplans mit einem Leistungsdiagnostiker bzw. einer sportmedizinischen Abteilung zusammen, ansonsten wird man sich der bekannten „Pi-mal-Daumen“-Techniken bedienen müssen, um die erforderliche Herzfrequenz zu bestimmen. Nicht optimal, aber immer noch besser als nichts. Viel Spass und Erfolg bei der Umsetzung der Vorschläge und lasst uns wissen, ob Euch diese Zusammenfassung geholfen hat. Wir freuen uns immer, von Euch zu hören! Quellen Bower, J. E. (2014). Cancer-related fatigue—mechanisms, risk factors, and treatments. Nature Reviews Clinical Oncology, 11(10), 597–609. https://doi.org/10.1038/nrclinonc.2014.127 Krebs - Krebs gesamt. (o. D.). www.krebsdaten.de. Abgerufen am 27. Juni 2021, von https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Krebs_gesamt/krebs_gesamt_node.html Lai JS, Cella D, Chang CH, Bode RK, Heinemann AW (2003) Item banking to improve, shorten and computerize self-reported fatigue: an illustration of steps to create a core item bank from the FACIT- Fatigue Scale. Qual Life Res 12(5):485–501 McNeely, M. L. & Courneya, K. S. (2010). Exercise Programs for Cancer-Related Fatigue: Evidence and Clinical Guidelines. Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 8(8), 945–953. https://doi.org/10.6004/jnccn.2010.0069 Mendoza, T. R., Wang, X. S., Cleeland, C. S., Morrissey, M., Johnson, B. A., Wendt, J. K. & Huber, S. L. (1999). The rapid assessment of fatigue severity in cancer patients. Cancer, 85(5), 1186–1196. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0142(19990301)85:5 Meneses-Echávez, J., González-Jiménez, Ramírez-Vélez, R. & Correa-Bautista, J. (2015). Effects of health professional supervised multimodal exercise interventions on cancer-related fatigue: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Physiotherapy, 101, e997. https://doi.org/10.1016/j.physio.2015.03.1859 Moss-Morris, R. & Hamilton, W. (2010). Pragmatic rehabilitation for chronic fatigue syndrome. BMJ, 340(apr22 3), c1799. https://doi.org/10.1136/bmj.c1799 Pachman, D. R., Barton, D. L., Swetz, K. M. & Loprinzi, C. L. (2012). Troublesome Symptoms in Cancer Survivors: Fatigue, Insomnia, Neuropathy, and Pain. Journal of Clinical Oncology, 30(30), 3687–3696. https://doi.org/10.1200/jco.2012.41.7238 Pedersen, B. K. & Febbraio, M. A. (2008). Muscle as an Endocrine Organ: Focus on Muscle-Derived Interleukin-6. Physiological Reviews, 88(4), 1379–1406. https://doi.org/10.1152/physrev.90100.2007 Seyidova-Khoshknabi, D., Davis, M. P. & Walsh, D. (2010). Review Article: A Systematic Review of Cancer-Related Fatigue Measurement Questionnaires. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 28(2), 119–129. https://doi.org/10.1177/1049909110381590 Wood, L. J., Nail, L. M. & Winters, K. A. (2009). Does Muscle-Derived Interleukin-6 Mediate Some of the Beneficial Effects of Exercise on Cancer Treatment-Related Fatigue? Oncology Nursing Forum, 36(5), 519–524. https://doi.org/10.1188/09.onf.519-524 Yellen, S. B., Cella, D. F., Webster, K., Blendowski, C. & Kaplan, E. (1997). Measuring fatigue and other anemia-related symptoms with the Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) measurement system. Journal of Pain and Symptom Management, 13(2), 63–74. https://doi.org/10.1016/s0885-3924(96)00274-6 von David SchmidtMittlerweile ist Licht am Horizont zu erkennen, aber noch immer beschäftigt uns die CoVid-19 Pandemie. Sie nimmt weiter Einfluss auf unser Leben, wie wir arbeiten, unsere Freizeit verbringen, beeinträchtigt unsere Psyche und teilweise sogar den sozialen Status. Zu vielen unter uns ging oder geht es körperlich, psychisch und/oder finanziell schlechter als vor der Pandemie. Zudem scheint sich bei manchen der Erkrankten „CoVid“, selbst nach der akuten Erkrankung, weiter fortzusetzen. Wie sich das zeigt, ob und was wir für therapeutische Optionen haben, werden wir hier erfahren.
Beim Lesen nicht verwirren lassen: Das Virus bzw. die Pandemie ist unter dem Namen CoVid-19 weitläufig bekannt. Genauer gesagt handelt es sich aber um das Coronavirus SARS-CoVid-2. Wann immer es also um SARS-CoVid-2 gehen mag, geht es auch immer um „unsere“ Pandemie CoVid-19. Die „Coronafamilie“ Es wird Zeit, dass wir uns mit den Coronaviren näher beschäftigen. Es werden sieben für den Menschen relevante Coronaviren unterschieden. Sie verursachen akute Atemwegserkrankungen die meist problemlos ausheilen, jedoch gelegentlich, vor allem bei Komorbiditäten, zu schweren Verläufen führen können. Der Name der Viren leitet sich vom bekannten Erscheinungsbild der Virusoberfläche ab, die an eine Krone (lat. »corona«) erinnert. Die Fortsätze dieser Krone werden von den sogenannten Spikes („Glykoproteinen“), gebildet, die in die menschlichen Zellen eindringen und die Infektion auslösen können. Sie haben dabei einen Durchmesser von nur etwa 120 Nanometer, den millionsten Teil eines Millimeters! Relevant sind diese Spike-Proteine dann, wenn es um neue Virusmutationen geht. Dann sind es nämlich genau sie, welche sich verändern und die Medizin und Forschung vor teils neue Herausforderungen stellen. (Ziebuhr, Kapitel: Coronaviren aus Mikrobiologie und Infektiologie, 2020;) Coronaviren können meist bis zu mehrere Tage überleben und werden relativ leicht von Mensch zu Mensch durch Aerosole übertragen. SARS-CoV-2 vermehrt sich stark im Nasen-Rachenraum und sind sehr empfindlich gegenüber Desinfektionsmitteln. Es lässt sich leicht durch Erhitzen und die empfohlenen Hygienemassnahmen (Hände waschen/desinfizieren, Mundschutz und Abstand halten) in Schach halten und die Übertragungsrate so deutlich reduzieren. Die Viren besiedeln in erster Linie die Epithelzellen der Atemwege bzw. Lunge und die der Blutgefässe, da diese besonders stark mit dem Empfänger, dem Angiotensin-konvertierendes Enzym 2 (ACE-2) ausgekleidet sind. Allerdings fühlt sich as Virus auch in anderen Organen wie den Nieren und dem Darm sehr wohl. Infektionen mit Coronaviren treten vor allem in den Wintermonaten auf und sind für insgesamt etwa 5–30 % aller akuten Atemwegserkrankungen verantwortlich. (Ziebuhr, 2020;) Typischerweise können Coronaviren zu einer Rhinitis (Entzündung des Nasenraums), Konjunktivitis (Bindehautentzündung), Pharyngitis (Rachenentzündung) und gelegentlich auch zu einer Otitis media (Mittelohrentzündung) führen. Infektionen im Kleinkindalter zeigen sich häufig als Laryngotracheitis (Kehlkopfentzündung), unter Eltern weitläufig bekannt als „Pseudokrupp“. Die Inkubationszeit der genannten Erkrankungen beträgt in der Regel 2–4 Tage und die Krankheitssymptome klingen meist nach einer Woche wieder ab. Eine Mitbeteiligung der unteren Atemwege ist, wie wir gerade erleben müssen, häufiger, als noch vor wenigen Jahren angenommen. Stationäre Behandlungen von Patienten mit akuten Infektionen der unteren Atemwege (Pneumonie, Bronchiolitis, Bronchitis) sind bei Kindern in etwa 8 % (bei Erwachsenen 5 %) der Fälle auf Coronaviren zurückzuführen. Akute Attacken von Asthma bronchiale infolge einer Coronavirus-Infektionen sind häufig beschrieben worden. (Ziebuhr, 2020;) SARS-CoVid-2 ist bereits bis zu zwei Tage vor dem ersten Auftreten von Symptomen ansteckend. Die Inkubationszeit beträgt bei einer erstaunlichen Spannbreite von 3-14 Tagen ca. 5 Tage, . Infektionen mit SARS-CoV-2 können zu einem schweren, häufig auch lebensbedrohlichen Krankheitsbild führen, das als schweres akutes Atemwegssyndrom („severe acute respiratory syndrome“, SARS) oder auch ARDS („acute respiratory distress syndrome“) bezeichnet wird. Neben sehr vielen schwach bis sogar asymptomatischen Patienten, sind typische Symptome u.a. plötzlich einsetzendes hohes Fieber, Muskelschmerzen (Myalgien), trockener Husten, schweres Krankheitsgefühl und Schüttelfrost. Im weiteren Verlauf der Erkrankung kann es zur Atemnot aufgrund mangelhafter Sauerstoffsättigung im Blut kommen, die dann eine intensivmedizinische Behandlung mit künstlicher Beatmung erfordert. Komplikationsreiche Verläufe von SARS-CoV-2-Infektionen sind häufig mit männlichem Geschlecht, hohem Alter, vorbestehenden kardiopulmonalen Erkrankungen und Diabetes Typ 2 assoziiert. Die Letalität liegt bei SARS-CoVid-2 bei ca. 0,5–1 % aller positiv getesteten Personen. Was für Beschwerden können anhalten? Die langfristigen Folgen einer CoVid-19 Infektion bleiben für den Moment noch spekulativ. Es gibt keine spezifischen Symptome oder Anzeichen, welche auf die allgemeine Schwere der CoVid-19-Krankheit hinweisen. Wenn anhaltende Probleme festgestellt werden, sollte der/die Patient*in an multidisziplinäre Rehabilitationsspezialisten überwiesen werden. Es gibt zwar starke Hinweise darauf, dass es zu multiplen Schäden an verschiedenen Organsystemen kommen kann, die dafür verantwortlichen Prozesse sind aber noch nicht vollumfänglich geklärt. Prof. Blasi von der Universität Mailand zufolge leiden 60% bis 70%, der aus dem Krankenhaus entlassenen Patient*innen, an Fatigue und 40% bis 70% an Kurzatmigkeit. Hinzu kämen Schmerzen, kognitive Beschwerden (Konzentrationsschwäche, Wortfindungsstörungen etc.), reduzierte körperliche Leistungsfähigkeit, Stimmveränderungen, fortbestehenden Husten, Verlust von Geruchs- und Geschmacksinn und viele weitere Symptome, die die Lebensqualität beeinträchtigen. (Fraser, 2020; Wade, 2020;) Häufig sind zudem Depressionen, Angst- und posttraumatische Belastungsstörungen, besonders bei intensivmedizinisch behandelten Patienten. Diese genannten Symptome im Rahmen intensivmedizinischer Behandlungen sind bereits seit Langem unter dem Synonym PICS („post-Intensive-Care-Syndrome“) bekannt. Daher ist es unter Wissenschaftlern noch umstritten, ob das mittlerweile geläufige „post-CoVid“ bzw. „long-CoVid“ tatsächlich als eigenständige Problematik zu klassifizieren ist. Ein häufig vergessenes, aber immens wichtiges und häufig betroffenes Organ scheint das Herz zu sein. In einer Studie von Puntmann et al. (2020) der Uniklinik Frankfurt am Main, wurden 100 genesene CoVid-19 Patient*innen auf kardiale Folgen der Erkrankung untersucht und es fanden sich bei 78% der Proband*innen Veränderungen am Myokard, bei 60 Proband*innen waren sogar noch akute Myokardentzündungen nachweisbar. Interessant war bei dieser Studie, dass nur 1/3 der Proband*innen stationär behandelt wurden und 2/3 zuhause die CoVid-19 Infektion überstanden haben. Dieses Ergebnis, einer zugegeben kleinen Stichprobe, zeigt auf, dass auch von CoVid-19 Genesene kardiologisch abgeklärt werden sollten. Bitte denkt bei Euren post-CoVid-Patient*innen daran! Was passiert in der Lunge? Mehr als ein Drittel der Patient*innen entwickeln fibrotische Veränderungen an der Lunge, mit einer Betonung der Lungenunterlappen (Mo, 2020; Wang, 2020). Bei 47% der Fälle erfolgt eine Störung der Diffusionskapazität und bei 25% war die Gesamtlungenkapazität reduziert (Mo, 2020). Die Fibrosen sind wahrscheinlich die Folge der initialen alveolären Entzündungsvorgänge mit einer massiven Ausschüttung proinflammatorischer Zytokine, Fibroblasten- und Myofibroblastenaktivierung, sowie folgender exzessiver Kollagendeposition im Lungengewebe. Die wirksamsten Therapieoptionen scheinen derzeit Kortison und antifibrotische Medikamente wie Pirfenidon und Nintedanib zu sein. Da diese Beschwerden auch vorübergehender Natur sein können, ist es zwar noch zu früh von Spätschäden an einzelnen Organen oder Organsystemen zu sprechen, aber wir müssen davon ausgehen, dass Patient*innen eine anhaltende Funktionsstörung diverser Organsysteme entwickeln und somit verschiedene physische und psychische Symptome aufweisen können. (Blasi S. COVID-19: Long term impact: the lung and beyond. ERS International Virtual Congress 2020, 7-9 Sept.; Wade, 2020;) Was empfiehlt die Wissenschaft? Internationale Gesellschaften, wie die British Thoracic Society (BTS), die American Thoracic Society (ATS) und die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) empfehlen post-stationären und/oder symptomatischen post-CoVid-19 Patient*innen gezielte Rehabilitations- und Nachsorgemassnahmen. Das eine pulmonale Rehabilitation bei CoVid-19-Patient*innen wirksam ist, belegen immer mehr Studien. Unteranderem konnte gezeigt werden, dass eine 6-wöchiges Rehabilitationsprogramm, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Interventionen, eine Verbesserung der Lungenfunktionsparameter, der Diffusionskapazität, der körperlichen Leistungsfähigkeit und der Lebensqualität aufwies. Zudem waren das Angst- und Depressionslevel in der Interventionsgruppe niedriger. Eine retrospektive Analyse aus der Schweiz konnte diese Ergebnisse bestätigen. Im Laufe der Rehabilitation verbesserte sich die 6-Minuten-Gehstrecke um klinisch signifikante 130 Meter (Virtuelles Pneumo Update, 13.11.2020; Pneumonews 2020 (12,6)). Die DGP empfiehlt, vergleichbar mit den Leitlinien aus den USA und Grossbritannien, rehabilitative Therapien bereits auf der Normal- bzw. Intensivstation zu beginnen und diese als pneumologische Frührehabilitation im Akutkrankenhaus oder als Reha-Heilverfahren fortzusetzen. Barker-Davies et al. (2020) bestätigen diese Empfehlungen mit ihren Erkenntnissen aus Grossbritannien, dass bis zu 50% der Krankenhauspatient*innen mit CoVid-19 eine fortlaufende Behandlung benötigen, um die langfristigen Ergebnisse zu verbessern. Solange die Inhalte einer CoVid-19-spezifischen Rehabilitation nicht definiert sind, sollten sich die Maßnahmen an denen bei der primären Lungenfibrose (IPF) orientieren. (Virtuelles Pneumo Update, 13.11.2020; Pneumonews 2020 (12,6); Barker-Davies et al., 2020) Was haben unsere „klassischen“ Pulmopatienten während dieser Zeit zu beachten? Für die besonders gefährdete Patientengruppe der „COPD`isten“ gelten laut Prof. Vogelmeier (Universitätsklinik Marburg) weiterhin die folgenden Empfehlungen: „Wenn bei COPD-Patienten neue oder gesteigerte respiratorische Symptome, Fieber und/oder andere Symptome auftreten, die einen Bezug zu COVID-19 haben könnten, auch wenn diese nur von milder Ausprägung sind, sollten die Betroffenen getestet werden. Die Patienten sollten ihre orale und inhalative respiratorische Medikation wie verordnet unverändert einnehmen, da diese Substanzen nach bisheriger Datenlage sicher und effektiv sind – unabhängig davon, ob eine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt oder nicht. Dies gilt auch für den Einsatz von oralen und/oder inhalativen Steroiden. In Regionen mit hoher SARS-CoV-2-Prävalenz sollte die Durchführung einer Spirometrie auf Patienten beschränkt bleiben, die dringend einer Diagnosestellung bedürfen und/oder der Status der Lungenfunktion zwingend erhoben werden muss. Die körperliche Distanz und das Tragen von Masken oder der Rückzug in das häusliche Umfeld sollten nicht zu einer sozialen Isolation und Inaktivität führen. Die COPD-Patienten sollten aktiv bleiben. Eine jährliche Influenzaimpfung sollte sichergestellt sein. Die Vernebelung von Medikamenten sollte wegen einer möglichen Aerosolbildung, wenn möglich, vermieden werden. Im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion wird auch bei COPD-Patienten eine Therapie mit systemischen Steroiden und/oder Remdesivir empfohlen. Bei respiratorischem Versagen sollte eine Hochflusssauerstofftherapie, eine nicht invasive Beatmung oder, wenn das nicht ausreicht, eine invasive mechanische Ventilation zum Einsatz kommen. CoVid-19-Patienten mit schweren Verläufen bzw. anhaltenden Einschränkungen sollten eine pneumologische Rehabilitation erhalten“. Was haben wir für physio- bzw. trainingstherapeutische Optionen? Barker-Davies et al. (2020) schreiben, dass die pulmonale Rehabilitation Atemnot reduzieren, die Funktionsfähigkeit im Alltag erhöhen und die Lebensqualität bei Personen mit Atemwegserkrankungen verbessern kann. Nach CoVid-19 wird sich die Anzahl der Rehabilitationsbedürftigen, durch diejenigen die auf der Intensivstation behandelt werden mussten, noch weiter steigern. Der größte Teil der Fachliteratur wird in älteren Populationen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder in jüngeren Gruppen mit Asthma berichtet. Es liegen jedoch Belege für die Anwendung von pulmonaler Rehabilitation bei Lungenentzündung, interstitieller Lungenerkrankung (ILD) und SARS vor. Bewegungstraining gilt dabei als Grundlage der pulmonalen Rehabilitation und ist in den allermeisten internationalen Programmen enthalten. Für die Trainingsplanung braucht es in der pulmonalen Rehabilitation leistungsdiagnostische Belastungstests zur Vorgabe individueller Schwellenwerte und exakter Trainingsbereiche, sowie physiotherapeutische Tests (6-Minutengehtest, 1-Minute-sit-to-stand/5-Rep-max und Handkrafttest;) als vergleichende Ein- und Austrittswerte. Eine Überwachung von Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung (Pulsoxymetrie) und Blutdruck während der Aktivität wird empfohlen. Die Aktivitäten können dabei durch eine subjektive Bewertung (Borg-Skala) der wahrgenommenen Anstrengung beschrieben werden. Ausdauer- und Krafttraining sind zentrale Bestandteile der pulmonalen Rehabilitation und sollten von Anfang an in der Physiotherapie im Einzelsetting und im späteren Gruppentraining aktiv gefördert werden. Dies kommt nicht nur der allgemeinen Fitness zugute, sondern beeinflusst auch eine Reihe anderer Probleme wie Müdigkeit und Fatigue, emotionale Dysbalancen, mangelndes Selbstvertrauen, die Durchführung ermüdender Alltagsaktivitäten und ermöglicht ökonomischere bzw. effizientere Atemmuster. Aufgrund der verhältnissmässig kurzen Erfahrungswerte mit der Erkrankung und den Folgen von CoVid-19, ist es sehr wichtig, dass Ärzt*innen und Therapeut*innen den post-CoVid-Patient*innen gegenüber ehrlich sind und sich selber eingestehen, ein gewisses Mass an Unsicherheit bzgl. der Prognose und den Erwartungen nach der CoVid-19 Erkrankung zu haben. Es ist im Reha-Verlauf besonders wichtig, die Betroffenen in einem multidisziplinären Setting zu betreuen und sich als Fachperson permanent auf dem aktuellen Stand der Forschung zu halten. (Wade, 2020) Referenzen
von David Schmidt Unzählige Praxisinhabern und Teamleitende haben massive Probleme neue, gut qualifizierte Mitarbeiter zu finden und ihr Team zusammenzuhalten.
Hohe Fluktuationen sind leider keine Seltenheit in unserem Job – so wie in den meisten Gesundheitsberufen. Die sozialen Medien sind randvoll mit Stellenangeboten und die Arbeitgeber hoffen in den bekannten Foren verzweifelt auf Antworten und Gründe zu ihrer glücklosen Suche. Ein möglicher Teufelskreis ist uns allen bekannt: Der Mitarbeiter verlässt die Praxis, bestehende Patienten können kaum - oder nicht im gewohnten Rahmen - versorgt werden. Infolgedessen werden keine neuen Patienten mehr angenommen, der Umsatz sinkt während die Fixkosten gleich bleiben. Das kann prekäre Folgen für das Fortbestehen der Praxis haben. Warum ist es so schwierig passende Angestellte zu finden? Was erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Suche und warum haben manche Praxen einen ständigen Wechsel im Betrieb? Wir (Pascale & David) haben weder bei science2practice noch in unseren hauptberuflichen Anstellungen Mitarbeiterverantwortung. Wir kennen den Druck und die Herausforderungen nicht, haben daher einen grossen Respekt vor Allen die sich in das kalte Wasser Selbständigkeit schmeissen. Das heisst, wir werden hier und jetzt nicht versuchen uns als Fachpersonen aus dem Bereich Human Resources oder als erfolgreiche Praxisinhaber darzustellen. Das sind wir nicht. Wir zitieren lieber tatsächliche Fachleute und Firmen aus dem Rekrutierungsbusiness und werden daraus unsere eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Wir hoffen der Beitrag gefällt und stellt sogar den einen oder anderen Gedankenanstoss dar. Feedback ist erwünscht. ;-) Was ist mit den Arbeitnehmern los? Was sind Kündigungsgründe? Zum Einstieg einige Auszüge aus den Untersuchungsergebnissen des „Engagement Index“ von Gallup, einem grossen US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen, und der Untersuchung „Die Zeit ist reif. Glücklich arbeiten“ (23‘000 Teilnehmer weltweit, 2‘400 in Deutschland) des Rekrutierungsunternehmens Robert Half:
Basierend auf Untersuchungen und Aussagen von Robert Half/Personalvermittler (roberthalf.de), Prof. Marina Fiedler, Lehrstuhl für Management, Personal und Information an der Universität Passau und Nico Marks von happinessworks.com sind für deutsche Arbeitnehmer die folgenden drei Punkte die wichtigsten Faktoren für Zufriedenheit am Arbeitsplatz:
Einfach mal Zuhören! Nehmt euch die Zeit und hört bitte regelmässig seriös zu. Mitarbeiter wollen laut Gallup (2013) gehört werden. Vorgesetzte sollen herausfinden was ihre Angestellten gerne und gut machen. Sie wollen entsprechend eingesetzt werden. Sie wollen stolz sein und wertgeschätzt werden, für das was sie tun. Das geht nur über regelmässige und persönliche Gespräche. Wenn das nicht passiert, wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit zu Frustration und Resignation führen. Die innere Kündigung kann folgen, aber mit einfachen Mitteln wirksam verhindert werden. Nutzt es! Den eigenen Führungsstil hinterfragen! 69% der Befragten in der Studie von Robert Harf gaben an, bereits mindestens einmal einen schlechten Chef gehabt zu haben. Gleichzeitig sind aber 97% der Vorgesetzten von ihren eigenen Führungsqualitäten überzeugt. Man sieht, Fremd- und Eigenwahrnehmung unterscheiden sich. Die allerwenigsten Vorgesetzten sind so gut wie sie sich selber sehen. Hinterfrage dein Handeln, sei ehrlich zu dir selbst und verstehe Kritik von Angestellten nicht als Angriff auf deine Person. Besuche Führungsseminare, fang an Fachliteratur zu lesen oder hole dir einen Spezialisten zur Seite der dich coacht. Möglichkeiten für Hilfe und Unterstützung gibt es viele. Es lohnt sich für dich und dein Team. Wie erhöht sich die Chance den passenden Bewerber zu bekommen und Mitarbeiter zu halten?
Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Suche und danken für deine Aufmerksamkeit! David SchmidtViele unserer Patienten könnten Bücher zu gut gemeinten Empfehlungen schreiben, die sie bezüglich ihrer Erkrankungen oder Verletzungen erhalten haben. Aus dem Bekannten- und Freundeskreis, von Ärzten oder auch von uns Therapeuten.
Empfehlungen und „Informationen“ zum Beispiel zu erfolgversprechenden Therapieinterventionen, gezieltem Training, gesunder Ernährung, optimalem Schlaf- und Bewegungsverhalten, richtiger und falscher Haltung, - natürlich auch zum Stressmanagement und einigem mehr. In diesen Tagen gerne im Rahmen der hochgejubelten „Patient/Pain Education.“ Aber ist gut gemeint auch gut für die Patienten? Sind wir qualifiziert und befugt diese abzugeben und was, wenn sich diese nachteilig auswirken? Worauf ist bei Tipps und Ratschlägen zu achten? Empfehlungen zu bestimmten Therapien, ob medizinischer oder therapeutischer Natur, sind manchmal ein heisses Eisen. Einerseits orientieren sich glücklicherweise immer mehr Kolleginnen und Kollegen an der Evidenz, was allerdings keine Garantie für einen fallspezifischen Therapieerfolg ist und auch nicht sein kann. Andererseits sind wir, bewusst oder unbewusst, Geiseln unserer eigenen Erfahrungen bzw. unseres BIAS und erzählen teilweise hanebüchenen Unsinn. Natürlich ist unsere persönliche Berufserfahrung, auf die sich die allermeisten von uns sehr gerne und ausführlich beziehen, wichtig. Aber in der Evidenzpyramide ist sie doch der wackeligste Stein. Stellt euch vor ihr seid der Patient und die Therapie ist sinnbildlich ein sich im Bau befindendes Haus. Baut ihr das Fundament eures „Therapiehauses“ lieber auf einem Stein (Einzelmeinung/Fallstudie) oder auf mehreren tausend Steinen (Metastudien)? Eben. Seien wir uns dessen stets bewusst und ehrlich zu uns selbst. Vor allem aber zu unseren Patienten, wenn diese nach „unserer Meinung oder Erfahrung“ fragen! Sie nehmen Zeit und Unkosten auf sich, um zu uns zu kommen, sie vertrauen uns ihre Gesundheit an und verdienen es angemessen behandelt und beraten zu werden. Das gilt selbstverständlich für jede Frage, jede Bitte um Empfehlungen betreffend jedem physiotherapeutisch abdeckbaren Themengebiet. Wir sind aufgrund unserer ganz persönlichen Fachexpertise und unserer Möglichkeiten externe Expertise zu suchen, zu finden und zu nutzen befugt und qualifiziert Empfehlungen abzugeben. Wir sollten dies auch nach Möglichkeit machen und versuchen, die Fragen unserer Klienten seriös und vollumfänglich zu beantworten. Dabei kann es helfen, dass wir uns folgendes zu Herzen nehmen: (angelehnt an Prof. Thorsten Weidig, Sportpsychologe und Daniel Riese, Physiotherapeut MSc und PhD cand.) · Wir müssen in der Lage sein, seriöse und nachprüfbare Quellen für unsere Empfehlungen zu nennen. Nichts ist weniger wert als alles auf die eigene Meinung zu beziehen und damit zu begründen. · Tipps und Empfehlungen sollen auf Augenhöhe kommuniziert werden. Die Wahrscheinlichkeit das unser Gegenüber das Gesagte annimmt steigt deutlich. Kommunizieren wir mit unseren Klienten doch einfach so, wie wir es selber auch erwarten und uns wünschen würden. · Kommunizieren wir offen, ehrlich, wertfrei und vor allem positiv. Wir sollten unser Gegenüber motivieren und in seinen Handlungen stärken, ihn nicht niedermachen, ängstigen und definitiv keine Nocebos einpflanzen. Angst ist kein guter Ratgeber, denn sie ist zumeist unnötig, kann Symptome auslösen oder verstärken und Rehaprozesse verlangsamen bzw. sogar behindern. Bitte beachtet das auch für Beiträge auf den bekannten Kommunikationskanälen (Webseiten, Facebook, Instagram, LinkedIn etc.). · Wir müssen aufpassen, was wir alles so im Internet und auf Social Media finden und schnell mal teilen. Wenn wir uns nicht die Zeit nehmen die Artikel zu lesen und zu bewerten, laufen wir Gefahr Blödsinn und Unausgegorenes zu teilen und weiter zu verbreiten. Das kann nicht in unserem Sinne und dem unserer Profession sein. Es soll natürlich keinen abhalten diesen Blogbeitrag zu teilen ;-) · Lasst uns nur Empfehlungen zu Themen abgeben, bei denen wir tatsächlich auf Draht sind. Wissenslücken sind keine Schande. Informieren wir uns vorher selber in den bekannten Journals und Datenbanken oder lasst uns die nötigen Infos bei Experten besorgen. · Nutzen wir die Bitten und Fragen nach Empfehlungen in Herrgottsnamen nicht dazu, nachgewiesenermassen sinnlose und unnütze Gimmicks zu verkaufen. Natürlich haben wir es verdient anständig bezahlt zu werden und die eigene Wirtschaftlichkeit ist ein hohes Gut, aber bitte nicht zum Nachteil der Patienten. Verkaufen wir das was Sinn und uns ausmacht - unser Wissen - zu einem ordentlichen Preis, aber lasst uns dabei bitte seriös bleiben. Vor allem wenn wir behaupten, evidenzbasiert zu arbeiten… · „Schuster bleib bei deinen Leisten“. Wenn wir auf Augenhöhe mit den anderen „Playern“ im Gesundheitswesen agieren und von Ihnen als Spezialisten wahrgenommen werden wollen, sollten wir es selber vorleben. Wir sollten deren Expertise anerkennen und respektieren. Wir sind keine Virologen, Chirurgen, keine Pharmazeuten und auch keine Psychologen. Daher sollten wir es auch tunlichst vermeiden, uns so zu verhalten oder meinen so agieren zu dürfen. Ein Vielflieger kann dem Piloten auch nicht erzählen, wie er das Flugzeug zu fliegen hat. Stellt euer Ego hinten an. Am Ende haben jene Therapeuten den grössten Erfolg und werden als kompetent wahrgenommen, die empathisch und sympathisch auftreten. Denen hören die Patienten gerne zu und sie setzen die erhaltenen Empfehlungen wahrscheinlich auch eher um. Wer zu forsch, unfreundlich, besserwisserisch auftritt oder Empfehlungen abgibt nach denen gar nicht gefragt wurde oder schlichtweg keinen interessieren, der wird schlussendlich in der Therapie kaum eine Chance haben. Unsere Therapie sollte sich durch Empathie, seriöse und belegbare Informationen und Empfehlungen und angepasstes Training auszeichnen und wird langfristig so auch uns zufriedenstellen. Geht positiv und unvoreingenommen an eure Patienten ran. Egal was auf der Diagnose steht oder welche Vorurteile durch so manche Patienten wie auch immer ausgelöst werden sollten. Nehmt sie wie sie sind, akzeptiert ihre Schwächen, freut euch an ihren guten Seiten und behandelt sie seriös, sympathisch und mit Respekt. Dann kommen dabei hoffentlich auch die passenden Ergebnisse raus und unsere Arbeit macht direkt mehr Spass. Stimmt ihr uns zu oder was sind eure Vorstellungen zu diesem Thema? Wir sind gespannt auf eure Meinungen! David Schmidt Viel hat man in den letzten Jahren über das Thema Einsamkeit gesprochen. Es wurden Bestseller geschrieben, Studien erstellt, Talkrunden im TV durchgeführt und sogar speziell ausgerichtete Abteilungen in Ministerien gegründet. Durch die Corona-Krise und dem damit verbundenen Lockdown, ist die Gesellschaft aber das erste Mal wirklich mit dem Thema Einsamkeit konfrontiert worden. Das erste Mal war und ist sie für eine breitere Masse der Gesellschaft spürbar. Aber wer von uns weiss wie Einsamkeit definiert wird, welchen gesellschaftlichen Stellenwert sie hat und warum sie auch für unsere therapeutische Arbeit von Bedeutung ist? Seien wir ehrlich, kaum einer von uns kennt sich mit Einsamkeit/Vereinsamung detailliert aus, oder? Fangen wir also an, unsere Lücken mit Wissen zu füllen! Los geht es mit der Definition: Einsamkeit wird als „unerfüllter Wunsch nach engen Bindungen zu anderen Personen, welcher ein subjektiv negatives Gefühl auslöst“ beschrieben (Quelle: Encyclopedia of Mental Health, 1998). Hält dieser Zustand dauerhaft an, spricht man von Vereinsamung (Quelle: Hospiz-Dialog NRW, 2015). Allerdings sollte man vorsichtig sein und das bekannte Alleinsein nicht als Einsamkeit falsch verstehen. Alleinsein ist ein neutraler und manchmal sogar positiv empfundener Zustand der Abwesenheit anderer. Jetzt werden viele von Euch an so manche Personen im eigenen Umfeld denken und genüsslich nicken… Basierend auf einer Umfrage der Europäischen Kommission aus 2018 mit 28’000 EU-Bürgern zu diesem Thema, geht man von ca. 41 Millionen EU-Bürgern (ca. 8 Millionen in Deutschland laut Institut der deutschen Wirtschaft im IW-Kurzbericht 2019, Zahlen für die Schweiz liegen nicht vor), bzw. 8% der Gesamtbevölkerung, aus, die sich als einsam bezeichnen. Der grösste Anteil einsamer EU-Bürger lebt in Südosteuropa Bulgarien liegt dabei mit 20% Einsamen an der Spitze. Es mag überraschen das besonders dieser Teil Europas (Rumänien 16%, Griechenland 12%, Kroatien 12% und Italien 9%;), mit seinen vermeintlich starken familiären Strukturen, offenbar wenig Halt für die Betroffenen zu geben vermag. Den geringsten Anteil einsamer Einwohner weisen ebenfalls unerwartet die Niederlande (3%), Dänemark (3%) und Schweden (5%) auf. Länder die für ihren gesellschaftlichen Individualismus bekannt sind. Woran liegt das? Hansen et al. haben sich 2019 dieser Frage angenommen und kamen zu dem Schluss, dass kollektivistische Länder das Wohlergehen sozialer Gruppen tendenziell dem Einzelnen überordnen und daher Einsamkeit dort eher vorkommt. Wer sich in diesen Gruppen gut integriert fühlt ist weniger oft einsam, als diejenigen die das Gefühl haben, nicht so eng miteinander verbunden zu sein. In individualisierten Ländern wie den Niederlanden und Dänemark geht man davon aus, dass die Gründe für Einsamkeit/Vereinsamung anders gelagert sind. Dort sind Menschen nicht gezwungen dem Gruppenideal zu entsprechen, müssen sich dafür aber mehr Mühe geben und einen höheren Aufwand betreiben, um enge qualitative Beziehungen aufzubauen. Diejenigen die den Aufwand nicht betreiben, haben ein erhöhtes Risiko zu vereinsamen. Wie es mit Studien halt so ist, gibt auch eine die der genannten widerspricht. Barreto et al. haben 2020 in einer Umfrage unter 46’000 Teilnehmenden das gegenteilige Ergebnis geliefert, allerdings war diese Arbeit grossteils auf England beschränkt und nicht repräsentativ für andere Länder. Unauffällig einsam Zusammenfassend kann man sagen, dass diese trockenen Zahlen eine unglaublich hohe Anzahl Menschen repräsentieren, die still und leise vor sich hin leben oder auch leiden, ohne dass der Grossteil der restlichen Gesellschaft sie bewusst als einsam wahrnimmt. Welche Folgen das für uns Therapeuten hat, dazu kommen wir gleich. Einsame Therapeuten? Wir Therapeuten sind täglich mit vielen Menschen in Kontakt. Manche wachen bereits neben einer Person auf, ob gewollt oder ungewollt, andere treffen auf dem Weg zur Arbeit und spätestens dann dort am Arbeitsplatz auf andere Individuen der Gattung Homo sapiens. Abends zu Hause wird dann oftmals noch in sozialen Netzwerken jeglicher Art gesurft, bevor es ins Bett geht und das Hamsterrad sich wieder aufs Neue beginnt zu drehen. Da stellt sich doch folgende Frage: Sind wir Therapeuten durch unsere Vielzahl an zwischenmenschlichen Interaktionen automatisch vor Einsamkeit sicher? Klare Antwort: Nein. Auch wir können betroffen sein. Es ist wichtig zu wissen, dass die Anzahl und Häufigkeit an sozialen Kontakten, zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder im Freundes- und Bekanntenkreis, keinen Einfluss darauf haben, ob wir uns einsam fühlen oder nicht. Manch eine/r ist trotz vieler sozialer Kontakte einsam, andere brauchen nur wenige Menschen um sich nicht einsam zu fühlen. Es gibt also keine definierte Schwelle, ab wann jemand einsam ist. Jede/r reagiert anders. Schlussendlich bleiben nur Befragungen und zu denen kommen wir jetzt. Einsamkeit quantifizieren Führend in der Erforschung der Einsamkeit/Vereinsamung sind die Briten. Seit 2018 haben sie, wie oben erwähnt, eine eigene Abteilung für Einsamkeit im Kulturministerium. Sie waren die ersten, die dieses offenbar weit verbreitete Problem ernst nahmen und mit ihren Untersuchungen dafür gesorgt haben, dass auch wir vom generierten Wissen profitieren können. Deren Untersuchungen ergaben, dass Einsamkeit durch alle Alters- und Bildungsschichten geht. Es betrifft Frauen und Männer, Stadt- und Landbewohner (Stadt<Land). Eine erste wichtige und gute Erkenntnis: Einsamkeit scheint, trotz unterschiedlicher Meinungen, gesamthaft nicht wirklich zuzunehmen. Sie wird aber auch nicht weniger. Sie ist eine Konstante. Sie ist und bleibt in allen Gesellschaftsschichten deutlich messbar präsent. Die höchste Rate einsamer Menschen (9% aller Einsamen) sind überraschenderweise die ach so vernetzt agierenden unter 24-jährigen und je älter wir werden, desto tendenziell besser scheint es sogar zu werden. Von einer „Einsamkeitsepidemie“ zu sprechen, wie es Manfred Spitzer 2018 in seinem Buch „Einsamkeit – die unerkannte Krankheit“ getan hat oder wie Christopher Masi von der University of Chicago behauptet „Einsamkeit sei auf dem Vormarsch“, wird von den britischen Vergleichsstudien nicht bestätigt. Allerdings müssen wir uns bewusst sein, dass das Beschwerdebild Einsamkeit Züge einer chronischen Erkrankung aufweist. Die körperlichen Folgen werden weiter unten aufgeführt. Wie wird man einsam? Einsamkeit kann im Laufe eines Lebens immer mal auftreten und auch wieder verschwinden. Wichtig ist es, den Zustand der oben definierten Vereinsamung zu verhindern. Die häufigsten Auslöser sind Ereignisse, die die Lebensumstände verändern. Dazu können Umzug, Jobverlust, Trennung, Scheidung, Mobbing, finanzielle Probleme, Todesfälle, persönliche Verhaltensmerkmale (Aufführung weiter unten) und paradoxerweise auch die Gründung einer Familie gehören (Luhmann & Bücker, 2019). Die erstgenannten Gründe sind sicher nachvollziehbarer als der letzte. Warum sollte eine Familiengründung, die Keimzelle der engsten und meist gewünschten Bindungen, negative Folgen haben können? Die Gruppe um Bücker führt an, dass die Einsamkeit im ersten Jahr nach der Kindsgeburt tendenziell besser wird, sich aber mit dem zweiten Jahr wieder verschlechtert. Die aufgeführten Gründe sind insbesondere die verkümmernden sozialen Kontakte und fehlende institutionelle Hilfestellungen. Dieser Mangel kann dazu führen, dass sich die Betroffenen eher gesellschaftlich ausgeschlossen fühlen. Daher dürfen und sollten auch „glückliche“ Eltern bei auffälligen psychischen Verhaltensweisen bzw. Befunden nach dem allgemeinen Befinden und speziell auch auf eine mögliche Einsamkeit hin angesprochen werden und entsprechende Optionen aufgezeigt bekommen. Wer das derzeit ständig benutzte und zitierte biopsychosoziale Modell in der Therapie tatsächlich leben will, kommt am Punkt Einsamkeit/Vereinsamung demzufolge nicht länger vorbei. Vielleicht denkt jetzt so manch Eine/r von Euch:
Wer weniger als 1136 € monatlich zur Verfügung hat, gilt in Deutschland als arm. Manch ein Therapeut, besonders im Osten der Republik, ist davon leider gar nicht so weit entfernt. Oft hört man die Binsenweisheit Menschen in armen Ländern seien glücklicher. Wir haben keinen Beleg gefunden, dass das stimmt. Eher das Gegenteil scheint näher an der Wahrheit zu liegen. Die einsamsten Europäer finden wir in Bulgarien, Rumänien und Griechenland. Alles Länder die nicht bekannt sind für ausufernden Reichtum und weit verbreitete Dekadenz. Sicher aber ist: Wenn ein Mensch in verhältnismässig reichen Gesellschaften, wie denen in Europa, verarmt, ist er oder sie deutlich eingeschränkter in seiner oder ihrer Teilnahme an gesellschaftlicher Interaktion. Er oder sie kann sich soziale Kontakte schlichtweg nicht mehr leisten. Einsamkeit und Vereinsamung können die bittere Folge sein. Krank und einsam Kranke Menschen in Deutschland berichten zu 18% über Einsamkeit. Mehr als doppelt so viel wie der Bundesdurchschnitt. (Eyerund & Orth, 2019) Häufig sind lang anhaltende Beschwerden und Krankheiten einhergehend mit körperlichen (Beweglichkeit/Ausdauer/Leistungsfähigkeit) und finanziellen Einschränkungen, die wiederum das Gefühl der Einsamkeit verstärken. Einsamkeit kann zu deutlichen und relevanten körperlichen Symptomen führen, die durchaus denen von permanentem Stress gleichzusetzen sind:
Es ist umstritten ob Einsamkeit ein Persönlichkeitsmerkmal darstellt, allerdings scheinen folgende Charaktereigenschaften bei einsamen Menschen gehäuft vorzukommen:
Veränderte Schmerzverarbeitung durch Einsamkeit Wenn ihr Euch diese Symptomliste und die assoziierten persönlichen Merkmale anschaut, gilt natürlich wie immer: Nicht jeder Patient hat oder zeigt alles und die Ausprägung von Beschwerden ist sehr variabel. Trotzdem fallen uns Korrelationen auf, die wir zum Beispiel von akuten und chronischen Schmerzpatienten kennen. Ein hohes Stresslevel, Schlafprobleme, Bewegungsmangel und eine schlechte Regenerationsfähigkeit haben einen direkten Einfluss auf die Wahrnehmung bzw. Ausbreitung der Symptome und natürlich auf die Effizienz unserer Therapie. Selbst den wenigen, noch rein strukturorientierten, Therapeuten unter uns sollte jetzt auffallen, wie wir unsere Therapie mit dem Wissen um Einsamkeit/Vereinsamung noch besser bzw. langfristig erfolgreicher gestalten könnten. Vielleicht hilft es auch einfach nur, etwas weniger enttäuscht bei frustrierenden Verläufen zu sein. Ihr seid nicht immer schuld, wenn es zu keiner Verbesserung kommt. Manche Umstände lassen sich zum Teil einfach nicht korrigieren. Das gilt es, wenn man vorher die empfohlenen Therapieoptionen befolgt hat, zu akzeptieren. Warum sprechen die Betroffenen eigentlich so selten offen darüber? Einer britischen Studie aus dem Jahre 2018 unter 2’001 Jugendlichen und jungen Erwachsenen (16-25 Jahre alt) zufolge, wurden am häufigsten die folgenden Aussagen bestätigt:
Die Schamgrenze, bei Frauen höher als bei Männern, scheint daher derart hoch zu sein, dass wir nicht erwarten können das unsere Patienten von selber uns davon erzählen. Wir müssen bei Verdacht (Merkmale/Symptome etc.) gezielt nachfragen! Da nur 19% der Betroffenen das Gefühl haben Ernst genommen zu werden, sollte man es entsprechend professionell empathisch und ernsthaft erfragen. Was sind empfohlene Therapieoptionen für Patienten, Kollegen oder Freunde die unter Einsamkeit/Vereinsamung leiden? Allgemeine Tipps:
Wollt ihr mehr zum Thema Psychologie und Kommunikation erfahren, ohne dass Gefühl zu haben als Psychologen tätig sein zu müssen? Machen Euch gewisse Patientengruppen Mühe oder würdet ihr schlichtweg gerne einen „roten Kommunikationsfaden“ an die Hand bekommen?Wir können Euch da Prof. Thorsten Weidig sehr empfehlen. Thorsten wird Euch vom 31.10.-01.11.2020 (in Zürich) im Kurs „Training und Reha aus sportpsychologischer Sicht“ ganz nach dem Motto „Reden statt Jammern“, effektive Kommunikationstechniken an die Hand geben, um die Adhärenz von Euren Patientinnen und Patienten zu verbessern und damit Eure Therapie- und Trainingsergebnisse positiv beeinflussen zu können. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer auf www.science2practice.ch. Ansonsten schreibt uns gerne an info@science2practice.ch oder ruft uns einfach an: +41786420597.Wir freuen uns immer von Euch zu hören und vielen Dank für Euer Interesse! Pascale & David Pascale Gränicher Der Jojo-Effekt der Physiotherapie – Teil 1
Jeder der schon einmal in der Physiotherapie war kennt das: Man bekommt (hoffentlich) ein Übungsprogramm mit einer Empfehlung, wie oft und wie intensiv das Training absolviert werden soll. Während der ersten, zweiten, dritten oder sogar vierten Physio-Verordnung macht man vielleicht noch mehr oder weniger regelmässig seine Hausaufgaben. Wenn dann die Therapie abgeschossen wird – meistens aufgrund von erreichter (momentaner) Beschwerdefreiheit (jeey) – verschwindet der Papierschnipsel irgendwo in der Schublade, in einem tiefen Nebentäschchen des Turnbeutels oder landet direkt im Müll. Denn das Problem ist ja jetzt gelöst. Lustig eigentlich. Denn manchmal mag es tatsächlich der Fall sein, dass der ursprüngliche Grund der Beschwerden über den Zeitraum der Therapie verschwunden ist. In vielen Fällen aber – gerade bei der «Volkskrankheit» Rückenschmerzen, kommen das Zwicken, Drücken, Stechen oder Brennen so sicher wie ein Bumerang wieder zurück. Denn den Schmerzen liegt meistens nicht ein strukturelles, sondern ein habituelles Problem zu Grunde: der Bewegungsmangel. Und der löst sich nicht über ein oder drei oder zehn Verordnungen Physiotherapie! Ist ja nett, dass man während dieser Therapie-Phase ein paar Übungen macht, sozusagen im günstigen Personaltraining und seine Wirbelsäule danach besser spürt, vielleicht sogar die ominösen tiefen Bauchmuskeln kennen lernt. Aber das Bewusstsein, woher die Schmerzen kommen, wird in den meisten Fällen nicht entwickelt. Und eine Zahnbürste zu erhalten, ohne zu wissen wofür das gut sein soll, hilft nur solange, wie einem die Zähne geputzt werden. Macht nämlich auch kein Spass, aber wir haben mal verstanden, dass es eben nötig ist. Wenn der Rücken das nächste Mal schlapp macht, sucht Herr oder Frau Rückenschmerzen lieber wieder den Arzt auf und lässt sich eine frische Runde Physiotherapie verschreiben, anstatt die verstaubten Übungen aus der Schublade zu ziehen. Und weiter geht’s: Zurück auf Feld 1. Um ehrlich zu sein, finde ich es als Physiotherapeutin erstaunlich, dass sich diese Jojo-Patienten nicht langweilen… Aber das verhält sich vielleicht gleich wie bei der Diät: Die nächste wird bestimmt die Richtige sein! Und ja keine langfristigen Gewohnheiten ändern – das könnte ja noch etwas nützen… Der Jojo-Effekt der Physiotherapie – Teil 2 Es ist ein besonders schönes Erlebnis, wenn man als Physiotherapeutin eine ehemalige Patientin im Fitnesscenter antrifft und sie über 3 Jahre nach Therapieabschluss weiterhin mindestens zweimal pro Woche ihre Übungen macht! Liebe Dara.: You made my day! Dara betont, dass sie auch in einer 6-Tage-Woche auf keinen Fall auf ihr Training verzichteten möchte und hat sogar ein eigenes Trainingssystem mit Hilfe von Karteikarten entwickelt. So trainiert sie jede Muskelgruppe regelmässig und kann die «erledigten» Übungen auf das jeweilige Häufchen ablegen. Das hilft, meint Dara, um die Übersicht zu halten und nicht nur die Lieblingsübungen zu machen. Um sich selber auszutricksen sozusagen. Noch ‘ne Runde? Dara kam mit verschleppten Kniebeschwerden in die Physiotherapie. Ihr Ziel war es, wieder joggen zu können. Das war zum Zeitpunkt unseres Erstbefundes nicht möglich. Die Röntgenbilder zeigten Abnutzungserscheinungen im Tibofemoralgelenk. Die Arbeit in der Spitex forderten ebenfalls ihren Zoll. Dara war zu Beginn skeptisch gegenüber einem erneuten Anlauf in der Physio – hatte sie doch schon (weniger gute) Erfahrung mit unsereins gemacht. Und die Diagnose war auf dem Röntgenbild ja augenscheinlich – Knochen auf Knochen – das sollte man besser nix belasten, oder? Aufklärung und Erklärung warum wir was machen ist ein essentieller Bestandteil der Physiotherapie. Erst wenn die Patienten verstehen, warum wir welche Intervention als indiziert erachten und welche Rolle sie selber im Rehaprozess spielen (nämlich die Hauptrolle), ist ein erfolgreicher Verlauf (für beide Seiten) möglich. Wir Therapeuten sind nur Regisseuren. Wir geben Empfehlungen, spielen exemplarisch vor, leiten an und korrigieren. Mit abnehmender Häufigkeit und Intensität. Aber spielen muss der Patient selber. Die das können wir nicht für ihn. Und das will geübt sein. Regelmässig. Use it and use it Mit Dara fokussierten wir in der Therapie zu Beginn auf einen dosierten Belastungsaufbau und starteten ganz niederschwellig im koordinativen Bereich. Dara war selber erstaunt, dass sie gewisse Muskelgruppen anfänglich kaum ansteuern, geschweige denn in einer Bewegung zueinander koordinieren konnte. Die raschen Fortschritte durch das fleissige Üben motivierten die 40-jährige und überzeugten sie von der Wichtigkeit des (Kraft-)Trainings – auch für sie als Ausdauersportlerin. Nach und nach konnte intensiver dosiert werden und Dara kam nicht nur neuromuskulär, sondern auch konditionell an ihre Grenzen. Diese wusste sie aber gekonnt zu überspringen und pushte sich weiter. Neben dem Krafttraining lernte Dara das Gehen aus einer neuen Perspektive kennen. Eine allgegenwärtige Bewegung, die uns in die einzelnen Bewegungsabläufe unterteilt doch so fremd erscheint. Nach und nach konnten über das Lauf-ABC erste Joggingversuche gestartet werden. Und siehe da: Die Knieschmerzen blieben aus. Das extensive Intervalltraining mit Gehpausen erlaubte es Dara, sich schrittweise ans Joggen heranzutasten. Ein ausführliches Aufwärmen aller beteiligten Muskelgruppen spielte dabei stets eine wichtige Rolle. Parallel dazu spickten wir das Krafttraining mit explosiven und später reaktiven Komponenten. Selbst ist die Frau Zu betonen gilt es, dass Dara während der niederfrequenten Physio-Termine ihr Training zuverlässig und regelmässig ausübte und wir uns während der Therapielektion auf die Intensivierung, Justierung und den Feinschliff konzentrieren konnten. Dass sich Dara bei Therapieabschluss eine selbstverständliche Trainingsroutine angeeignet hatte, freute mich natürlich schon dazumal sehr. Sie hatte realisiert, dass sie alleine für ihr Knie verantwortlich ist. Dara konnte zweimal pro Woche beschwerdefrei ihre Joggingrunde absolvieren und war auch im Alltag ohne Schmerzen unterwegs. Der Transfer war geglückt. Rück(en)spiegel Dass Dara auch über 3 Jahre nach Therapieabschluss an ihrer Trainingsroutine festgehalten hat, ist natürlich unglaublich erfreulich. Umso mehr, als dass sich ihr Knie schon hin und wieder meldet, wenn sie mal ferienhalber nicht so konsequent im Fitnesscenter ist. Aber sie weiss was sie zu tun hat, um das Knie im Griff zu behalten. Und mit diesen Werkzeugen ausgestattet, dreht Dara beschwerdefrei ihre Joggingrunden. Herzlichen Dank für das tolle Feedback liebe Dara! Sie ist ein Musterbeispiel für eine Patientin, die Verantwortung übernimmt und sich bewusst ist, dass sie alleine die Zügel in der Hand hält. Wir können den Patienten die Werkzeuge bereiten und die nötige Unterstützung beim anfänglichen Einsatz bieten, aber benutzen müssen sie sie selber (wollen). Und verstehen, warum der Rücken wieder schmerzt, wenn sie es nicht tun. Pascale Gränicher Die Publikation des Faktenblattes des BAG hat mir einige Fragezeichen auf die Stirn gemalt. Geht es anderen Physiotherapeuten auch so?
Wir befinden uns in einer Krise, ok. Physios dürfen nur noch «Patienten mit medizinischer Dringlichkeit behandeln» und es ist dabei «die gleiche Behandlungsqualität wie bei einem direkten physischen Kontakt mit den Patientinnen und Patienten sicherzustellen“. Somit sollten sich für die über Video behandelte Person keinerlei Nachteile im Vergleich zur Therapie in der Praxis ergeben, oder? Weiter schreibt das BAG in Bezug auf die Videobehandlungen: „Leistungen der Physiotherapie, die auf räumliche Distanz erbracht werden können, beschränken sich auf Massnahmen der Beratung und Instruktion“. Eine Gelegenheit, um bereits den Blick auf die Zeit nach der Corona-Krise zu werfen? Schätzungsweise 80-90% der physiotherapeutischen Behandlungen im ambulanten Bereich könnten somit theoretisch per Video-Call durchgeführt werden, nicht? Denn ich stimme dem BAG zu, in einem Video-Call kann ich einen Patienten wunderbar in seinen Übungen instruieren, korrigieren und zu seinem Problem beraten. Klar ist es schöner, wenn man sich die Hände schütteln darf, und ganz alle Interventionen funktionieren über die räumliche Distanz natürlich nicht. Aber die Behandlungsqualität soll ja in der aktuellen Krise gewährleistet bleiben und muss auch aus meiner Sicht durch die physische Distanz nicht unbedingt leiden. Was kostet UNS THERAPEUTEN die Video-Behandlung? Den Tarif, welche die Physiotherapeuten nun für die Videobehandlung abrechnen dürfen, beträgt weniger als die Hälfte des regulären Sitzungstarifs (7340 Medizinische Trainingstherapie anstelle 7301 Einzelsitzungspauschale). Zu betonen gilt es, dass es sich bei diesen Patienten ja um jene «mit medizinischer Dringlichkeit» handelt. Ich bin überzeugt, dass die Physiotherapeuten diese Menschen auch ohne Eid und trotz einer Entschädigung, die unter 50% der bescheidenen Norm liegt, wenn irgendwie möglich, weiterbehandeln. Appelliert das BAG hier an uns Gutmenschen? Denn mit dieser Vergütung muss ich mir schon überlegen, ob ich meine Zeit während der Krise nicht besser in etwas anderes als die Betreuung von «Patienten mit medizinischer Dringlichkeit» investiere? Einfach nur schon, weil es sich überhaupt nicht lohnt? Obwohl, unter dem MTT-Tarif müsste ich als Therapeut ja eigentlich nur die Kamera einstellen und könnte mehrere Patienten gleichzeitig trainieren lassen? Aber das ist ja wohl auch nicht die Idee… Oder? Für mich als Therapeutin ergibt sich für die Videobehandlung genau der gleiche Aufwand:
Notnagel oder Chance? Wenn wir nochmals zurückkommen auf «die Zeit nach der Krise»: Wäre es nicht eine Idee, einen neuen Tarif «Videobehandlung» anzugehen? Mit fairer Entschädigung? Die ausnahmslose Regel sollte diese Form der Fernbehandlung nicht werden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele Patienten froh wären, in einer fortgeschrittenen Phase ihrer Reha, bei guter Compliance und zufrieden stellendem Verlauf, nicht wöchentlich (mehrmals) in die Praxis reisen zu müssen, sondern von zu Hause aus gecoached werden könnten. Oder auch bei längerer Ferienabwesenheit. Die reisefreudigen Millenials würden es bestimmt schätzen, die Beratung beim Physio ihres Vertrauens in Anspruch nehmen zu können – auch vom anderen Ende der Welt aus. Die Videobehandlung würde aus meiner Sicht die Selbstverantwortung der Patienten stärken und der (manuellen) Abhängigkeiten zum Therapeuten vorbeugen. (z.B. Fr. H. die schon die 27. Verordnung wegen Nackenschmerzen bekommt, weil sie nicht bereit ist, etwas für die Verbesserung ihrer Situation beizutragen.) Aber da wäre ein separater Tarif für Videotherapie schon sinnvoll, nicht? Und einer, der nicht noch weniger als die Hälfte des Standardtarifs ausmacht, wäre irgendwie auch schön. Gerade, da ja «die gleiche Behandlungsqualität wie bei einem direkten physischen Kontakt mit den Patientinnen und Patienten sicherzustellen» wäre. Naja, ein Denkanstoss, der vielleicht bis in nächsten Tarifverhandlungen rollt. Und vielleicht auch mal etwas Zusätzliches ins Rollen bringt in der Physiotherapie. Denn mittlerweile frag ich mich schon, weshalb die Ergotherapeuten und Logopäden (mit bewundernswertem Verhandlungsgeschick?) ihren Tarif «pro Sitzung und Tag zweimal abrechnen» dürfen, die Physio-Schafe aber nicht? Was so ein Faktenblatt nicht alles für Fragen aufwirft… Gemeinsam sind wir osterhasenstark!Ich wünsche mir sehr, dass sich die Physiotherapie in absehbarer Zeit aus dem Sumpf kämpft, wo sie sich seit Jahrzehnten nicht vom Fleck bewegt. Mit science2practice versuchen wir einen Betrag zur evidenzbasierten (Physio-)Therapie zu leisten und im selben Zuge auch zum kritischen Hinterfragen vom aktuellen Gesundheitssystem anzuregen und konstruktive (interdisziplinäre) Diskussionen zu unterstützen. Denn auch bei Tarifverhandlungen ist faktenbasiertes Argumentieren unerlässlich. Und die Wissenschaft liefert diese Fakten. Die Erfahrung alleine, was dem letzten Patienten wohlgetan hat, nützt leider nicht viel wenn’s darum geht, die Position der Physiotherapie zu stärken. Was ist eure Meinung zum Thema Therapie über Video-Call? Was denken andere Disziplinen darüber? Wir sind gespannt! Frohe Ostern und herzliche Grüsse Pascale & David Marco GrigoliEin Gastblog vom ehemaligen Weltcup-Skispringer aus dem Engadin  Der ungewisse Blick in die Zukunft. Der ungewisse Blick in die Zukunft. Kaum ein Moment vergeht, in welchem die sportliche Karriere eines Athleten in dessen Kopf und Herzen nicht präsent ist. Der Lebenslauf, ein Konstrukt, geformt und geprägt durch den Sport selbst. Etliche Jahre an Vorbereitung, Training und Arbeit, um dem stets gebliebenen Kindheitstraum in kleinen, harten Schritten näher zu kommen. Man verzichtet auf Vieles im Leben und widmet sich kompromisslos seiner Leidenschaft. Der Lohn dafür findet sich in der grenzenlosen und immer wiederkehrenden Adrenalinausschüttung, welche in einem gewissen Masse abhängig macht und in den unbezahlbaren Emotionen, die man rund um den Globus erlebt, wieder. Gerade in Risikosportarten ist man sich stets bewusst, dass der Preis für den eigenen Traum hoch ausfallen kann. Denn innert wenigen Sekunden kann ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit nicht nur den Traum zum Platzen bringen, sondern auch viele lange Jahre harter Arbeit zunichtemachen – die Verletzung. Wann kann ich wieder…? Im ersten Moment nach der Verletzung sind es die Emotionen und der eigene Wille, die einem über den inneren Schweinehund immer wieder eintrichtern, dass es nicht so schlimm sein kann und in absehbarer Zeit wieder alles beim Alten ist. In meinem Fall kam die Hiobsbotschaft ca. 5 Stunden nach dem Unfall, nachdem sämtliche Untersuchungen in Zürich abgeschlossen waren. Obwohl ich eine Auflistung von Bänderrissen, Frakturen und sonstigen Fremdwörtern vor mir sah, war ich immer noch der Überzeugung, dass es lediglich ein Eingriff benötige und ich spätestens im Sommer wieder ins Trainingsgeschehen eingreifen kann. Von der Verletzung bis zur vollständigen Einsicht, dass ich diesen Sport nicht mehr betreiben kann, vergingen rund zwei Jahre. Während dieser Zeit richtete sich meine Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Genesung meiner komplexen Verletzung, mit dem Ziel, bald wieder einsatzbereit zu sein. Im ersten Moment bieten das Team und vor allem die Familie die nötige Unterstützung, mit den Umständen emotional umzugehen. Regelmässige Besuche von Freunden und Bekannten optimieren den ungewohnten Alltag. Ich musste mir eingestehen, dass es sich bei meiner Verletzung um etwas sehr Komplexes handelte und der Weg zurück schwieriger wird als gedacht. Ich war gezwungen, ein Teil der Kontrolle und der Verantwortung über meine Verletzung an Menschen abzugeben, welche das nötige Fachwissen besitzen, den Heilungsprozess voranzutreiben. In erster Linie waren es sicherlich die Ärzte, welche sehr schnell handelten und noch am selben Tag eine Operation durchführten und später regelmässig über den Verlauf der Heilung Auskunft gaben. Visiten durch Ärzte sind kompakt und zeitlich begrenzt. Das wichtigste über den Verlauf wird kurz besprochen und im selben Moment verabschiedet man sich vom Visiten-Detachement. Wegbegleiter Erst ab Beginn der Reha-Phase mit Einbezug der Physiotherapie beginnt die strenge aber wertvolle Arbeit hinsichtlich einer möglichen Genesung. Für mich war es von Anfang an klar, dass ich nicht mit einem beliebigen Therapeuten zusammenarbeiten kann. Schliesslich verbringt man mit dieser Person Stunden in Therapiezimmern, spricht über den persönlichen Gefühlszustand und über jene Gedanken, welche man lieber unterdrücken würde. Es war für mich von höchster Priorität in meinem/r Physiotherapeuten/in eine Vertrauensperson zu finden, welche mich nicht nur auf körperlicher Ebene unterstützt, sondern eben auch aus emotionaler Sicht Stabilität in den Heilungsprozess bringen kann. Physiotherapeuten arbeiten nahe und intensiv am Menschen. Ein grosses Vertrauen hinsichtlich des Fachwissens und des Menschen selbst musste für mich vorhanden sein. Irgendwie hatte ich damals das Gefühl, dass ich dies zu gut erkennen vermag und entschied mich bewusst dafür, die Arbeit nur mit einem bestimmten Therapeuten fortzusetzen. Bis heute weiss ich, dass ich mich damals absolut richtig entschieden habe. Die mentale Achterbahn Ich hatte Tage, an denen ich glaubte, bald wieder ordentlich und schmerzfrei gehen zu können und Tage, an denen sich Gedanken breit machten, dass ich aufgrund der diagnostizierten Arthrose später mit den eigenen Kindern nicht einmal mehr vollumfänglich spielen kann. Ich fand keinen wirklichen emotional-stabilen Zustand. Nach einer Weile wurde der Kontakt zum Team immer schwächer, da sie schliesslich im Sportzirkus stark involviert waren und ihren Aufgaben weiterhin bestmöglich nachgingen. Auch in meinen Gedanken distanzierte ich mich immer mehr von meinem Sport und meine Aufmerksamkeit galt dem alleinigen Heilungsprozess, unabhängig meiner sportlichen Karriere. Jeder noch so kleine Fortschritt wertete ich als grossen Erfolg, jeder Rückschlag als grosse Katastrophe. Nach einer intensiven Zeit mit bemerkenswerten Fortschritten kamen aus dem Nichts unangenehme Schmerzen zurück. Keine Schmerzen, welche unerträglich waren aber traten sie in einer Konstanz auf, die mich komplett durchdrehen liess. Wut und beinahe depressive Zustände waren das Resultat konstanter und stärker werdenden Schmerzen. Nach genauer Reflexion mit meinem Physiotherapeuten entschieden wir uns erneut für eine Rücksprache mit dem zuständigen Arzt. Ich kann mich gut an den Gesichtsausdruck des Arztes erinnern, …an welchem ich sofort erkannte, dass etwas nicht stimmte. Ein namhafter, sympathischer und extrem erfolgreicher Arzt schaute mich dermassen unsicher an, als ob er die Kontrolle über Raum und Zeit verloren hätte. Beinahe hatte ich ein schlechtes Gewissen, ihn in eine derartige Situation zu bringen. Er erklärte mir mit ruhiger Stimme und grossem Respekt vor meiner Person, dass die Arthrose stärker geworden sei und eine weitere Operation notwendig wäre, um den Schaden möglichst in Grenzen zu halten. Ab diesem Zeitpunkt wurde mir bewusst, dass wir soeben den Spatenstich für das Grab meiner sportlichen Karriere getätigt haben. Dennoch traf mich der Shock nicht wie erwartet, denn irgendwie habe ich mich bereits unbewusst auf diesen Moment eingestellt, da mein Körper derartige Signale seit geraumer Zeit ausstrahlte. Obwohl es für mich wohl das absolute worst case Szenario darstelle, fiel in diesem Moment grosse Last von meinen Schultern. Ich konnte mich von den Gedanken befreien, wieder professionell Sport zu betreiben und hatte ab sofort Klarheit und in gewissem Masse die Kontrolle über meinen Gesundheitszustand zurückerlangt. Ich wusste, dass niemand Fehler gemacht hatte und wir gut gearbeitet hatten. Lediglich mein Körper war dieser Aufgabe nicht gewachsen und zeigte mir diesbezüglich klar die Grenzen auf. Nach der Operation ging es für mich bergauf. Ich wusste zwar, dass ich nicht mehr um Edelmetall in meiner Sportart kämpfen konnte, war mir aber im Klaren darüber, dass ich irgendwann wieder schmerzfrei durch den Alltag gehen und bestimmte Hobbies erneut betreiben kann. In der nachfolgenden Zeit wurde aus der Patient-Physio Beziehung eine enge Freundschaft und die Reha ging auf neuer Ebene in die nächste Runde. Der Zeitdruck war weg und wir konnten nachhaltig weiterarbeiten. Mein Physiotherapeut hatte die Begabung, komplexe medizinische Fachsprache dem meinigen Wortschatz anzupassen und konnte mir sämtliche Prozesse rund um meine Reha begründen und erklären. Ich wusste, dass ich dieser Person blind vertrauen konnte. Heute darf ich sagen, dass die Reha ein voller Erfolg war. Obwohl ich mit Einschränkungen umgehen muss, gehe ich beinahe schmerzfrei durch meinen Alltag. Ich weiss, wann und warum Schmerzen auftreten und kann dies sehr gut steuern. Klar gibt es Sportarten, auf die ich ganzheitlich verzichten muss, wie z.B stop-and-go-Sportarten. Hingegen konnte ich nach rund 4 Jahren mit anderen Sportarten beginnen, welche nun verstärkt meinen Alltag prägen. Ein voller Erfolg! Dieser Unfall lenkte meinen Lebensweg in eine komplett andere Richtung. Es ergaben sich neue Chancen, Freundschaften und wundervolle Momente, welche ich als Sportler nicht erlebt hätte. Ich bin kein spiritueller Mensch, aber manchmal kommt tatsächlich alles so, wie es muss. Herzlichen Dank für die persönlichen Einblicke, die du uns in auf deinem Weg gewährst! Wir wünschen dir für deine Zukunft nur das Beste – und einen hochfliegenden Start ins 2020! David & Pascale @Sportphysiotherapeuten, Personal Trainer, Osteopathen, Ergotherapeuten, Trainer, Sporttherapeuten und eigentlich alle, die mit Leistungsportlern arbeiten: Prof. Thorsten Weidig ist im Oktober 2020 zum zweiten Mal in Zürich! In diesem Kurs wird erarbeitet, wie ihr eure AthletInnen auf dem Weg zurück an die Spitze, oder auf einer neuen Route in ihrem Leben ideal unterstützen und begleiten könnt. Wie wichtig dabei die Player Motivation und Kommunikation sind, hat uns Marco eindrücklich geschildert. Tickets gibt’s hier! Pascale Gränicher Was hat es eigentlich mit dieser „Evidenz“ bzw. der „evidence based practice (EBM) auf sich? Was kann evidenzbasiertes Arbeiten, wo liegen die Chancen aber auch die Grenzen? Worauf ist zu achten und wie wenden wir evidenzbasiertes Arbeiten in der Therapie an?
„Evidenzbasierte Medizin“ oder evidence based practice wird durch Sackett et al. (2007) folgendermassen definiert: „[Der] gewissenhafte, ausdrückliche und umsichtige Gebrauch der aktuell besten Beweise für Entscheidungen in der Versorgung eines individuellen Patienten“. Gehen wir dieses riesige Thema mal ganz „physiotypisch“ an. Zählen wir also erstmal auf, warum die Umsetzung vielleicht bei anderen funktioniert, aber ganz sicher nicht bei mir/ uns… Als bekannteste Barrieren für die Umsetzung von evidenzbasierter Arbeit in der Praxis gelten:
Was zeichnet eine „evidenzbasierte“ Arbeitsweise aus und wie könnte sie sogar finanziell lukrativ sein?
Anschliessend geht es um die Patientenpräferenzen, wo vollumfänglich über die Therapieoptionen aufgeklärt und die Wahl gegeben wird, die für sie stimmige Therapie auszusuchen. Es geht darum Wünsche und Vorstellungen zu eruieren und zu besprechen. Oftmals hören wir nur das, was unsere eigenen Überzeugungen und Theorien füttert, aber nicht das, was uns der Patient sagen will. Wir müssen besonders mit dem Anspruch der evidenzbasierten Praxis wieder lernen mehr zuzuhören. Der Patient soll seine Probleme auf Augenhöhe mit uns besprechen können. Die Expertise des Therapeuten bleibt davon unberührt, die therapeutische Krone vollzackig und wird zukünftig von den Patienten hoffentlich noch strahlender und beeindruckender wahrgenommen. 😉 Also… was nun?Machen wir uns nichts vor: Evidenzbasiertes Arbeiten ist besonders am Anfang aufwendig und anstrengend. Es erfordert mehr Einsatz als andere Therapieansätze. Dafür ist diese Vorgehensweise ethisch vertretbar, therapeutisch befriedigend, motivierend und steigert deutlich die eigenen therapeutischen Kompetenzen. Was macht EBP mit unserem Beruf? Ist dieses Thema nur eine momentane Mode oder steckt mehr dahinter? Die berufspolitischen Diskussionen zeigen deutlich, wohin der Weg geht und was passiert, wenn wir uns nicht schleunigst mit diesem Thema seriös auseinandersetzen. Wir sollten der Evidenz unsere Aufmerksamkeit widmen und den dringend notwendigen Platz in unserem Therapiemanagement einräumen. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen wählen den Weg der Akademisierung, ein durchweg sehr positives Signal. Wenngleich es auch an vielen Hochschulen im deutschsprachigen Raum qualitativ immer noch deutlich Luft nach oben hat. Trotz so mancher Defizite, ist die flächendeckende Akademisierung aber der richtige Weg und es ist davon auszugehen, dass die EBP deutlich mehr ist, als nur eine Modeerscheinung von ein paar „Physiohipstern“. Es zeigt die vermutlich einzig sinnvolle Zukunft unseres Berufes und den Weg zu einem besseren Standing im medizinischen Bereich auf. EBP kann zu einem immens wichtigen Argument für eine bessere Vergütung werden, wenn die Berufsverbände das Potential und die Möglichkeiten erkennen, welche sich da- hinter verstecken und nicht weiterhin ihr eigenes lukratives Zertifikatesüppchen kochen würden. Eines sollten wir aber nicht vergessen, schlichtweg zur Seite schieben oder unterschätzen:Wir müssen, aller teilweise auftretenden Schwierigkeiten zum Trotz, auch die nicht-akademisierten Kollegen in das therapeutische Boot holen! Nur mit vereinten Kräften können wir den festgefahrenen Wagen Physiotherapie aus dem Dreck ziehen. Das geht nur mit Respekt, Kommunikation auf Augenhöhe, durch die Anerkennung von Ängsten und Vorbehalten und immer wiederkehrender Erklärungen über EBM. Nur dann haben wir eine Chance unseren Beruf in einem überschaubaren Zeitfenster dorthin zu bringen, wo er verdient hat zu stehen. Gewiss sind noch dicke Bretter zu bohren, aber der Vorschlaghammer allein hilft da wenig. Es braucht Zeit, aber es kann sich lohnen. Was denkst Du über EBP? Wir sind gespannt auf Deine Meinung!Hast Du vielleicht sogar Lust bekommen, mehr zu diesem spannenden Thema zu erfahren? Dann bist Du herzlich eingeladen, auf www.science2practice.ch zu klicken und mehr über unser Angebot mit Daniel Riese und seinem „Research to practice“-Kurs vom 14.-15.03.2020 in Düsseldorf zu erfahren. Deine Fragen zu unseren Veranstaltungen stellst Du am besten direkt an science2practice. Wir würden uns freuen von Dir zu hören! Pascale Gränicher In jeder Therapiesitzung alle vier Ohren bereit zu halten und leichtfüssig von der Sach- zur Emotionsebene und wieder zurück zu hüpfen ist Tagesform abhängig (oder überhaupt!) nicht immer einfach.
Ein paar simple Anstösser aus dem (Physio-)Therapie-Alltag, die vielleicht auch deine vier Ohren unterstützen: Tipp 1: Unkompliziert So einfach wie’s klingt: Macht’s euch einfach. Die Patienten geben in den wenigsten Fällen zu, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Und sie sind auch nicht unbedingt beeindruckt, wenn wir Fachchinesisch brabbeln. Bildhafte, simple Erklärungen führen effizienter ans Ziel. Tipp 2: Weniger ist mehr Lieber kurz überlegen, was du dem Patienten erklären willst. Zu viele Details oder zu vertiefte Erläuterungen können eher verwirren. Konzentrier dich auf die wirklich relevanten Facts. Tipp 3: Again and again Wiederholung ist der Schlüssel. Erst wenn wir uns selber nicht mehr hören können, ist die Botschaft beim Gegenüber sicher angekommen. Tipp 4: The importance of being earnestAuf Augenhöhe kommunizieren und dabei möglichst wenig Interpretationsspielraum zulassen. Konkrete Ziele formulieren, eindeutige Hausaufgaben mitgeben (definierter Dosierung). So fühlt sich der Patient ernst genommen und weiss, was er zu tun hat. Selbstwirksamkeit ahoi und Verantwortung langsam abgeben. Tipp 5: Kein «warum» Offene Fragen sind wichtig. W-Fragen die mit «woher, wann, wieviel, weshalb, …» beginnen sind essentiell, um einen unverfälschten Eindruck des Gegenübers zu erhalten. Bei einer «warum»-Frage haben aber manche das Gefühl, sich verteidigen oder rechtfertigen zu müssen. Tipp 6: Vertrauen ist die halbe Miete Empathische Sprache, Fingerspitzengefühl: Nachfragen, ob das Gesagte verstanden wurde. Wiederholen lassen, geduldig bleiben. Blickkontakt baut Vertrauen auf. Nicht wie ein Wasserfall reden, deutliche Formulierungen wählen. …natürlich gibt es auch immer jene Gegenüber, die mit Fachchinesisch, schnellen Themenwechseln, ausgeklügelten Detailerklärungen und herablassendem Fachsimpeln einwandfrei zurechtkommen. Aber upgraden fällt in der Regel leichter 😉. Am 20./21.03.2020 und am 31.10./01.11. 2020 könnt ihr euer Wissen bzgl. Kommunikation und Motivation in der Therapie auffrischen und erweitern: Prof. Thorsten Weidig ist erneut in Zürich! -> Tickets & Infos findet ihr direkt auf Eventbrite oder hier. David Schmidt  14th Clinical Science Forum „Technologies and robotics for therapy“ Ausrichter: Stiftung Physiotherapie Wissenschaften PTW Gastgeber: Universitätsklinik Der Balgrist Prof. Mazda Farshad, Medizinischer Direktor der Universitätsklinik Balgrist, kam in seinen Begrüssungsworten mit Nachdruck auf die Wichtigkeit intensiver Forschung im Bereich muskuloskelettaler (MSK) Beschwerden zu sprechen. Gleichzeitig prangerte er die unverhältnismässig geringen Forschungsinvestitionen in diesem Bereich an. Dieser Widerspruch zeigt sich gut in folgendem Zitat des Klinikdirektors: „If we would not do research, the state-of-the-art would remain the same“. Farshad hebt hervor, dass MSK-Beschwerden einerseits – je nach Statistik – die höchsten bzw. zweithöchsten Gesamtkosten im Gesundheitssektor verursachen (2013 in der Schweiz: ca. 20 Milliarden Franken, Anteil der Physiotherapie bei ca. 700 Millionen Franken), anderseits werden gerade einmal 2% der Forschungsgelder für den Bereich der muskuloskelettalen Beschwerden eingesetzt. Dr. Oliver Stoller, PhD, PT, Manager Digital Health, VAMED: „Clinical integration of rehabilitation technologies – from stand-alone-solutions to ecosystems“, zeigte in seinem Vortrag eindrücklich auf, wie bereits jetzt, von vielen im therapeutischen Bereich völlig unbemerkt, Daten gesammelt, verarbeitet und genutzt werden. Nicht überraschend ist, dass die Krankenkassen derzeit die eifrigsten Sammler sind. Noch vor den Techfirmen (besonders der Medizintechnik) und weit vor den Rehakliniken. An letzter Stelle stehen die Rehazentren und Therapiepraxen. Fazit ist: Wir als medizin-therapeutische Experten schöpfen unser Potential an Wissensgenerierung nicht im geringsten aus. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Krankenkassen die gewonnenen Daten dazu nutzen werden, für Therapien nur noch entsprechend deren tatsächlichem Nutzen zu zahlen. Sind wir darauf vorbereitet oder befinden wir uns noch im „soweit-wird-es-schon-nicht-kommen“-Modus? Die Millionen-Dollar-Frage heisst: Wie können wir uns auf die technologischen Veränderungen einstellen und davon profitieren? Und wissen wir überhaupt, was unsere Patienten wollen? Technologisierung in der Therapie (Stoller) Für unsere Klienten hat die Medaille zwei Seiten, – die sich allerdings langfristig zu deren Vorteil entwickeln sollten. Einerseits zeigt sich laut Oliver Stoller, dass „Patienten mehr Hoffnung als Angst in Bezug auf Künstliche Intelligenz („AI“) in der Rehabilitation haben“ und sie aber andererseits „überhaupt keine Ahnung haben was derzeit läuft, sich dies allerdings bald ändern wird.“ Im Laufe der industriellen Revolution hat sich bereits viel getan. Es begann um 1780 mit den Entwicklungen der Dampfmaschinen, um 1880 ging mit der flächendeckenden Elektrizität und Massenproduktion weiter. Seit 1980 befanden wir uns in der industriellen Revolution 3.0: dem Computerzeitalter. Mit den Cyber physical systems sind wir bereits jetzt in der Revolution 4.0, mit enormen Auswirkungen auf Medizin und Therapie. Was bieten sich uns für Möglichkeiten und wo geht die Reise hin?Stoller meint dazu: „Oft haben wir keine Ahnung über die Dosierung in unserer Therapie und was die Patienten zu Hause machen“. Ein Patient kommt im Schnitt 1-2 pro Woche für je 30 Minuten zur Therapie und die restliche Zeit ist er oder sie auf sich gestellt. Im Grunde entscheidet sich der langfristige Therapieerfolg also selten in der Praxis. Entscheidend ist, was passiert wenn wir Therapeuten nicht dabei sind. Wäre es nicht fantastisch, Sensoren zu nutzen, die uns genau zeigen was Patienten zu Hause machen und wenn wir die Daten therapeutisch nutzen könnten? Kommunikation und Wissensaustausch zwischen allen Playern zum Wohle des Patienten Natürlich ist das Thema Datenschutz und -nutzung ein heisses Eisen. Die Generierung, Sammlung und Nutzung sollte unter strengen Auflagen erfolgen. Aber sind wir in anderen Bereichen genau so heikel? Alexa hört uns permanent zu, Siri sagt uns wie das Wetter wird und unsere iWatch zeichnet unseren Herzrhythmus auf und schickt diesen als PDF an unseren Hausarzt. Wir werden bereits massiv überwacht, ausgewertet und lassen unser Verhalten analysieren. Sollten wir diese Möglichkeiten nicht auch für unsere Gesundheit nutzen können? Von 2010 bis 2017 hat sich die Zahl an klinischen Untersuchungen unter Zuhilfenahme mobiler Endgeräte, Sensoren und Wearables fast verfünffacht. Die amerikanische FDA hat die Nutzung einer beeindruckenden Zahl an Algorithmen in der Medizin gestattet. AI betritt den medizinischen Sektor in einem fast unheimlichen Tempo! Besonders die Bereiche Radiologie und Kardiologie wandeln sich enorm schnell. Bereits jetzt ist erkennbar, dass der Radiologe in seiner jetzigen Form in absehbarer Zeit ausgedient hat und durch AI ersetzt wird. Der Einsatz von digital health technologies steigt weiter an Game over für den AlleskönnerTherapeuten sollten sich darauf einstellen, dass neue Technologien einen festen Platz im Therapieprozess einnehmen werden. Wie können Sie also reagieren? – Mit Spezialisierung. Es wird aller Voraussicht nach immer mehr Therapeuten geben, die sich in verschiedenen Bereichen spezialisieren (MSK, Geriatrie, Neurologie, Pädiatrie, Robotik, Forschung etc.). Der Therapeut-für-Alles wird ausgedient haben. Wie sich auch in anderen Vorträgen beim Clinical Science Forum gezeigt hat, wird das Curriculum im Studium angepasst werden müssen und der Bereich AI/Medical Engineering soll ein wichtiger Teil davon werden. Bereits jetzt kann beispielsweise in Wien ein Master-Studium im Bereich Medical Engineering & eHealth belegt werden. Und das ist scheinbar erst der Beginn. Diejenigen die flexibel sind und sich nicht vor Veränderungen scheuen werden profitieren, diejenigen denen das nicht gelingt, werden zwangsläufig auf der Strecke bleiben. Hoffentlich. Vielen Dank für Euer Interesse. David Jorge Ramón JiménezZur Bearbeitung hier klicken To the presents,
since humanity has a sense of reasoning people have been trying to explain everything, questioning anything, and that continuously gives us a clearer way of living, or that’s what we think. I’m a physical therapy specialist in Mexico, the country where I was born, I have six years of experience in this area. They are a few, but I can presume that by that time, I’ve been trying to search for the comprehension of the body, the mind and in the first instance, the individual. A very hard and difficult journey that we all need to do because nothing is the same for no one. So that’s the important thing in this note: Meeting people, colleagues, different points of view discovering the hot stuff of this important concept named “pain”, that may help each other for the ones that are out there searching for what is common for many people which is: getting better. Five years ago, I started a treatment method in a Hospital which is no more than the bases of what physical therapy is. It makes the patients feel better and more comfortable with what they apparently present as a “limitation”. And it’s curious because sometimes we forget the first things we learn, the start of the first book we read, the first day we meet a patient, the first words they say, and I think that sometimes there we could find the cure we search for. We never end something, we are just students every time, we learn and learn. We adapt, and we evolve. And that’s where I am, searching for more. I’ve been following Lars Avemarie since a couple of years ago, and the perspective that he has about PT is what amazes me and for sure many of you. Emphatic is one of the most favorite words of the last 5 years in the world I’m pretty sure about it, and that’s what I feel with him, with David Schmidt that has been the principal help and the leader of my trip to Switzerland. I’m traveling half the world to be with you all and to know the best from the best, and to be a helpful person to be the light in the dark, to discover the pain, for them, the people. I have a very special phrase, it’s something that has been following me for the last 10 years maybe more, I share it with my beloved ones, with the people who search for me in the clinic: “Ve más allá de lo que ves” (see beyond what you see). Pascale GränicherZur Bearbeitung hier klicken «Beim letzten Patienten hat das auch geholfen, also wende ich die gleiche Intervention beim Nächsten auch wieder an.»
Das könnte die Rohfassung einer Hypothesenformulierung für eine spannende Studie sein. In der Regel wird aber weder ein validierter Befund noch eine standardisierte Behandlung folgen, um die Wirksamkeit dieser hilfreichen Therapie zu überprüfen. Die eigene Erfahrung zählt schliesslich am meisten. Und da sind wir Physio- und Ergotherapeuten oder auch Osteopathen und Ärzte auch ganz objektiv. Denn schliesslich wissen wir was wir tun und blicken auf eine langjährige Erfolgsstory mit zufriedenen Patienten zurück. Somit muss es ja nützen was wir tun. Wissen was wir wissen Wäre es aber nicht toll, wenn wir nicht nur das Gefühl hätten, dass das was wir tun das Problem mit der bestmöglichen Wahrscheinlichkeit bei der Wurzel packt und uns nicht einzig auf unsere Erinnerungswerte verlassen müssten? Unsere Erfahrung als medizin-therapeutische Spezialisten zählt natürlich zu den Daten, anhand derer die individuell zielführendste Intervention herausgeschält werden kann. Aber eben nicht nur, denn unser Gedächtnis ist kein Archiv unverfälschter Fakten – leider. Erinnerungen sind veränderbar Wie bereits in den 70er Jahren erforscht wurde, sind unsere Erinnerungen plastisch, also veränderbar. Somit kann durch externe Einflüsse oder durch eigene Fantasie an unseren Erinnerungen geschraubt werden (Loftus et al., 1978). Wie veränderbar, zeiget der Versuch von Loftus & Pickrell (1995), wo Probanden davon überzeugt werden konnten, dass sie als Kind in einem Einkaufszentrum verloren gingen – obwohl nie etwas Vergleichbares geschehen ist. Wie fehlbar unsere Erinnerungen sein können, zeigen auch die vielen Fälle von unrechtmässigen Verurteilungen von Unschuldigen aufgrund von falschen Zeugenaussagen. Durch das Innocence Project (2017) konnten seit 1989 durch die DNA-Analyse in 353 Fällen unschuldig Verurteilte freigesprochen werden. 70% dieser Urteile wurden aufgrund von Zeugenaussagen gefällt. Und mit «falsch» ist nicht absichtlich fehlerhaft dargestellt, sondern verfälscht durch zeitliche Verzerrung oder suggestive Befragungstechniken der Untersuchenden gemeint (Bruck & Ceci, 1995; Ceci & Bruck, 1993). Wenn wir also überzeugt sind, dass etwas in einer Weise geschehen ist, dann können sich unsere Erinnerungen tatsächlich verändern und der neuen Geschichte anpassen. Das heisst, wir blenden möglicherweise Fälle aus, bei denen unsere Lieblingstechnik oder die favorisierte Dehnungsübung nichts geholfen oder sogar mehr Beschwerden verursacht hat. Das verdrängen wir unbewusst… natürlich. Können wir das nicht verhindern? Da werden wir ja von unserem Hirn total fremdgesteuert! Erinnern wollen Einen Sinn hat das Unterdrücken von unangenehmen Erinnerungen aber schon: Wie Waldhauser und Kollegen (2018) bei Personen, die an posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) litten untersucht haben, erleben diese die auslösenden emotionale Situationen gedanklich immer und immer wieder. Probanden, die vergleichbar traumatische Ereignisse erlebten, aber nicht an einer PTBS litten, zeigten in der Magnetenzephalographie (MEG) geringer ausgeprägte sensorische Gedächtnisspuren als die PTBS-Gruppe. Das heisst, sie konnten die emotionalen Assoziationen besser unterdrücken. Es gilt weiter zu untersuchen, ob nun die PTBS die Erinnerungssteuerung hemmt oder die Kontrollgruppe eine bessere Coping-Strategie aufwies. Aber unser Gehirn scheint eine eigene Zensurstube zu unterhalten, um die Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen zu beschleunigen. Ob eine nicht anschlagende Technik für den Therapeuten aber als Trauma interpretiert werden sollte ist natürlich fraglich. Ein reflektierter und selbstkritischer Profi kann einen Fehlversuch mit ausgeklügelter, individuell auf den Klienten angepasster Trainingsbatterie mit Athlet Marko ebenso in seine Datenerhebung integrieren wie eine himmelhoch-jauchzendes Erfolgserlebnis nach einer simplen Patient Education bei Frau Meier. Überzeugte Augenzeugen Wie können wir als Augenzeugen unserer eigenen Intervention nun einen zuverlässigen Datensatz an Therapieerinnerungen erstellen? Grundsätzlich nicht ganz so schwierig: Wie Untersuchungen mit Zeugenaussagen gezeigt haben, sind unsere Erinnerungen je näher am Ereignis desto zuverlässiger (Wixted et al., 2018). Das heisst, eine Verlaufsdokumentation direkt während oder nach der Behandlung, ermöglicht eine reliable Aussage. Ein Blick in die Notizen vor der nächsten Therapiesitzung ist dann natürlich ebenfalls gefordert. Hinter die Ohren schreiben Der Einsatz von sauber durchgeführten, standardisierten Verlaufskontrollen erhöht die Aussagekraft unserer Erinnerungen. Auch hier dürfen sich Therapeuten und Ärzte am ganzen Buffet der Assessmentmöglichkeiten Bedienen: Von Fragebogen über Leistungstests bis hin zu Labormessungen bietet uns die Befundkiste alles was das Herz begehrt. Die sorgfältige Auswahl und Prüfung der Qualität des jeweiligen Werkzeugs sollte dabei selbstverständlich sein. Als Detektive des menschlichen Körpers können wir uns nicht ausschliesslich auf Indizien und den Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft verlassen – wir brauchen stichhaltige Beweise und wasserdichte Alibis bevor wir ein Urteil fällen. Und auch unsere Goldstandards sollten regelmässig hinterfragt werden -wie auch das Federal Bureau of Investigation (FBI) regelmässig seine Standards für die DNA-Analyse, ein valides und reliables Instrument in der Kriminalistik, überprüft (FBI, 2001; National Research Council, 2009). Da wir in der Praxis in der Regel nicht unter Laborbedingungen hantieren, ist neben einem strukturierten Clinical Reasoning, den standardisierten Assessments und wirksamen Interventionen auch eine Portion gesunder Menschenverstand und eine Ladung zwischenmenschlicher Qualitäten unabdingbar. Denn Frau Meier geht es tatsächlich schon etwas besser, wenn sie uns mag und uns vertraut (Hall et al., 2010). Das ist doch auch schon etwas! Mehr dazu…Auch Lars Avemarie beschäftigt sich regelmässig mit der Frage des bestmöglichen Behandlungsansatzes. Und nicht nur durch trockene Theorie, oder wie er sagt: „Nothing could be more humanistic than using evidence to find the best possible approaches to care„. Es gibt noch Tickets für den zweitägigen Kurs vom 30.-31. August in Zürich! Zum Thema „Neuroscientific Painmodulation“ – oder wie man optimal mit Schmerzpatienten arbeitet, wird im Technopark referiert und diskutiert. Wir freuen uns auf euch! Literatur Bruck, M. & Ceci, S.J. (1995) AMicus brief fort he case of State of New Jersy v. Michaels presented by Committee of Concerned Social Scientists. Psychology, Public Policy, and Law; 1: 272-322. Ceci, S.J. & Bruck, M. (1993). Suggestibility oft he child witness: A historical review and synthesis. Psychological Bulletin; 113: 403-439. Gerd T. Waldhauser, Martin J. Dahl, Martina Ruf-Leuschner, Veronika Müller-Bamouh, Maggie Schauer, Nikolai Axmacher, Thomas Elbert, Simon Hanslmayr: The neural dynamics of deficient memory control in heavily traumatized refugees, in: Scientific Reports, 2018, DOI: 10.1038/s41598- 018-31400-x Hall, A.M. et al. (2010). The Influence of the Therapist-Patient Relationship on Treatment Outcome in Physical Rehabilitation: A Systematic Review. Physical Therapy; 90 (8): 1099-1110. Innocence Project (2017). Eyewitness misidentification. Retrieved from: https://www.innocenceproject.org/eyewitness-identification-reform/ Loftus, E. F., Miller, D. G. & Burns, H. J. (1978). Semantic integration of verbal information into a visual memory. Journal of Experimental Psychology. Human Learning and Memory; 4: 19–31. Loftus, E. F. & Pickrell, J. E. (1995). The formation of false memories. Psychiatric Annals; 25: 720–725. National Research Council (2009). Strengthening forensic science in the United States: A path forward. Washington, DC: National Academy Press. Wixted, J.T., Mickes, L. & Fisher, R.P. (2018). Rethinking the Reliability of Eyewitness Memory. Perspectives on Psychological Science; 13 (3): 324-335. U.S. Federal Bureau of Investigation Department of Justice (2011). The FBI quality assurance standards audit for forensic DNA testing laboratories. Retrieved from: https://www.fbi.gov/file-repository/qas-audit-for-forensic-dna-testing-laboratories.pdf/view Pascale Gränicher  Radiologische Untersuchungen bei nicht-spezifischen Rückenschmerzen schüren Ängste und verunsichern die Patienten. Altersentsprechende, „gewöhnliche“ Abnützungen ohne Link zu klinischen Symptomen führen missverständlich zu Verzweiflung, mehr Schmerzen und noch grösseren Einschränkung aufgrund von Angst und Schonverhalten. Der Glaube, dass die Wirbelsäule „kaputt“ oder „verletzlich“ sei, unterstützt zudem einen vermeidbaren Chronifizierungsprozess. Wir glauben was wir sehen Wollen wir glauben was wir sehen? Manchmal ja. Eine willkommene Erklärung für den Schmerz kann so ein Bild ja sein. Oder eine Entschuldigung, sich nicht mehr bewegen zu müssen. Das lebenslange Urteil einer „krummen“ Wirbelsäule, Gelenke wo „Knochen auf Knochen“ reiben oder Bandscheiben, die keine Flüssigkeit mehr enthalten oder „herausgesprungen“ sind. Sehnen und Gelenke, die dafür entzündliche Flüssigkeit enthalten und so Bewegung verbieten, ja sogar derentwegen noch angereichert würde. Da sollte doch Entspannung angeordnet werden?! Was passiert, wenn einem Patienten, der aufgrund von Schmerzen im Schulter-Nacken-Bereich in einer gebückten Schonhaltung verharrt ein Bild seiner von Arthrose «zerfressenen» Halswirbelsäule gezeigt wird? Bewegt er sich nun mehr oder weniger? Hängt das davon ab, ob der Arzt ihn zum einen oder anderen ermuntert, bzw. über den Zusammenhang von Arthrose, Bewegung, Degeneration und Schmerz aufklärt? Und ist Bewegung nun gut oder schlecht? Wieder eine andere Frage. Grundsätzlich bildet ein MRI, CT oder Röntgen nur einen einzigen Moment aus einer einzigen Perspektive ab. Und Schmerz sieht man nicht am Bewegungsapparat. Man sieht, wie die Struktur aussieht. Das ist alles. Aber ob das weh tut? Eine MomentaufnahmeEntgegen des primären Ziels, die Patienten mittels radiologischer Untersuchungen zu beruhigen und beschwichtigen, können Unsicherheiten und Ängste aufgrund (zufällig) entdeckter Abnützungserscheinungen verstärkt werden. Erhöhte oder prolongierte Einschränkungen z.B. durch nicht-spezifische Rückenschmerzen werden mit bildgebenden Untersuchungen der Wirbelsäule assoziiert. Erhöhte Gesundheitskosten, längere Phasen von Arbeitsunfähigkeit und reduziertes Wohlbefinden sind Konsequenzen einer nicht indizierten Bildgebung (Graves et al., 2012). Eine mögliche Erklärung wäre, dass gewöhnliche, altersentsprechend degenerative Merkmale, die keine Beschwerden auslösen für die Betroffenen erst im Moment der Bildaufnahme real werden. Die eigene Vergänglichkeit wird bewusst und das verunsichert. Wie sich in der Arbeit von Modic et al. (2005) herauskristallisierte, haben bildgebende Untersuchungen bei Patienten mit akuten Rückenschmerzen keinen signifikanten Einfluss auf den Genesungsverlauf oder das konservative Behandlungsresultat. Obwohl bei 60% der Probanden eine Diskushernie festgestellt wurde, konnte kein Zusammenhang zwischen Grösse oder Typ der Hernie und dem Symptomverhalten oder dem Outcome gefunden werden. Diejenigen, die von ihren Befunden erfuhren, schätzten ihr Wohlbefinden im Gegensatz zur verblindeten Gruppe tendenziell sogar schlechter ein. Brinjikji und Kollegen (2015) unterstützen dieses Ergebnis mit der Aussage, dass schon bei beschwerdefreien 20-jährigen bereits bei 37% eine Diskusdegeneration festgestellt werden kann. Und dieser Anteil wächst mit jedem Lebensjahr deutlich (96% bei asymptomatischen 80-jährigen). Ich habe heute leider kein Bild für Sie Was heisst das nun für die Praxis? Ist es nötig, eine radiologische Untersuchung anzuordnen, wenn der Befund weder auf das subjektive Empfinden des Patienten noch auf den Genesungs- und Reha-Verlauf oder das Outcome einen signifikanten Einfluss übt und keine Red Flags vorliegen? Therapeuten haben die Möglichkeit auf- und erklärend zu wirken. Ob schlussendlich ein bildgebendes Verfahren eingeleitet wird, entscheidet der Arzt gemeinsam mit dem Patienten. Aber wenn dieser Entscheid fällt, soll er bewusst getroffen werden. Im Anschluss wäre es schön, wenn man als Therapeut ebendiese Ängste relativieren oder nehmen, mit Mythen aufräumen und mit einem aufgeklärten Patienten das optimale Behandlungsresultat anpeilen könnte. Denn wie Darlow und Kollegen in ihrem Review (2011) feststellten, spiegelt sich die Überzeugung und die Haltung der betreuenden Fachperson in jenen der Patienten wider. Radiologie in der Praxis erklärt Die Bildinterpretation und Aufklärung radiologischer Befunde liegt klar in der Fachkompetenz der Mediziner. Tatsache ist, dass Patienten bei einem Erstbefund z.B. in der Physio-, Osteo- oder Ergotherapie häufig Fragen zu diesen Befunden stellen. In der Fachkompetenz der qualifizierten Therapeuten sollte es somit liegen, unsere Patienten beim Verstehen der ärztlichen Beurteilung zu unterstützen und ihnen die Konsequenzen – wenn es denn welche gibt – für den weiteren Therapieverlauf aufzeigen zu können. Ist der Unterschied zwischen MRI, Röntgen und. CT noch nicht ganz klar? Am 25. Mai 2019 gibt’s Unterstützung in Zürich –Thomas Nickl wird in einem Tagesseminar die verschiedenen Techniken dieser Momentaufnahmen auseinandernehmen und hoffentlich einen dauerhaften Eindruck hinterlassen. Tickets & Infos hier Literatur Brinkjikji, W. et al. (2015). Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR American Journal of Neuroradiology; 36(4): 811-816. Darlow, B., Fullen, B.M., Dean, S., Hurley, D.A., Baxter, G.D. & Dowell, A. (The association between health care professional attitudes and beliefs and the attitudes and beliefs, clinical management, and outcomes of patients with low back pain: A systematic review. European Journal of Pain; 16: 3-17. Graves, J.M., Fulton-Kehoe, D., Jarvik, J.G. & Franklin, G.M. (2012). Early imaging for acute low back pain: one-year health and disability outcomes among Washington State workers. Spine (Phila Pa 1976); 37(18): 1617-1627. Karran, E.L., Yau, Y., Hiller, S.L. & Moseley, G.L. (2018). The reassuring potential of spinal imaging results: development and testing of a brief, psycho-education intervention for patients attending secondary care. European Spine Journal; 27(1): 101-108. Modic, M.T. et al. (2005). Acute Low Back Pain and Radiculopathy: MR Imaging Findings and Their Prognostic Role and Effect on Outcome. Radiology; 237(2): 597-604. Svanbergsson, G., Ingvarsson, T. & Arnardottir, R.H. (2017). MRI for diagnosis of low back pain: Usability, association with symptoms and influence on treatment. Laeknabladid; 103(1):17-22. Pascale GränicherZur Bearbeitung hier klicken Neuer Erstbefund kurz vor Feierabend. Noch bevor ich den Herrn im Wartebereich begrüssen kann, werde ich von seinem Wortschwall eingedeckt: „Ich bin ja eigentlich schon in der Physio“, „Ich kenne schon alles, ich habe schon jegliches ausprobiert“, „Mein Rücken ist einfach nicht gut, wegen der Haltung oder so, er tut einfach weh“, „Alles hat nichts geholfen bisher…“….
Während ich den kreuzleidenden Patienten ins Behandlungszimmer bugsiere wird mir kaum ein Wort gewährt. „Also eigentlich bin ich hier für Massage.“ Erwartungsvoller Blick. Nur nicht laut denken Mein Magen verknotet sich, einmal tief durchatmen, freundlich lächeln: „Sie sind heute hier für einen Physiotherapietermin, das ist Ihnen bewusst, nehme ich an? Im Obergeschoss können Sie sich für Massagen anmelden was allerdings nicht durch die Grundversicherung abgedeckt ist.“ – „Ja, ja, aber ich bin ja schon in Therapie und habe ganz viele Übungen und soll dieses und jenes machen. Aber trotzdem ist das Rückenweh noch da.“ Wild gestikulierend versucht mir der Herr seine schmerzende Stelle im mittleren Rücken zu zeigen. „Und jetzt möchte ich Massage haben.“ Trotziger Blick. In den folgenden 20min versuche ich, wenn ich denn zu Wort komme, einerseits den Unterschied zwischen Physiotherapie und Wellnessmassage zu erläutern, die Bedeutung einer lösungsorientierten Behandlung zu verdeutlichen und gleichzeitig eine Anamnese durchzuführen. Kläglich gescheitert im Prozess. Ich habe das Gefühl, meine tollen, wissenschaftlich fundierten Erklärungsversuche und praktikablen, alltagsnahen Ratschläge sickern zu dem Herrn nicht durch. Also wirklich gar nicht. Will ich das können? In den vier Jahren des Bachelor-Studiums behandelten wir ca. einen Nachmittag lang das Thema „klassische Massage“. Warum haben die meisten Leute das Gefühl, dass Physiotherapie nur aus massieren besteht? Gibt es so viele Therapeuten die aus der scheinbar grenzenlosen Auswahl an Interventionen und Methoden nur diese eine wählen und anwenden? Wo sind die hypothesengesteuerten Behandlungen? Wird der Therapiefortschritt überprüft und evaluiert? Wird ein Ziel formuliert oder überlegt? Ich frage mich, was die Gesellschaft für ein Bild von mir als Physiotherapeutin hat… Auf meine Nachfrage hin, ob der Herr denn seine Übungen aus der vorangehenden Therapie auch mache, verneint er kurzangebunden. Es habe ja nichts gebracht. Ob er denn während den Übungen müde geworden sei? Wird ebenfalls verneint. Er habe sie einfach irgendwie gemacht. Nach dem Termin fühle ich mich leergesogen und ausgelaugt. Wir verbleiben so, dass sich der Herr gerne wieder melden kann, wenn er bereit ist, einen neuen Anlauf für gezielte Physiotherapie zu starten. Ansonsten solle er sich mit seinem Anliegen zur Wellnessbehandlung gerne bei einem Masseur melden. Ein irritierter Patient und eine frustrierte Therapeutin verabschieden sich. Adieu, Merci und auf Nimmerwiedersehen. Dachte ich. Der Morgen danach Am nächsten Tag teilt mir das Sekretariat mit, dass sich der besagte Herr für einen weiteren Termin bei mir angemeldet habe. Nun bin ich natürlich gespannt, ob tatsächlich ein kleines Bröcklein meiner Edukationsversuche hängen geblieben ist, oder ob das Ganze Prozedere von vorn los geht…. Aufgrund der völlig divergenten Erwartungshaltungen entstehen auf Therapeuten- oder Patientenseite immer wieder unnötig unangenehme Situationen. Klar kann ich mich an die vier Ohren erinnern, aber so ganz einfach ist die Umsetzung dann doch nicht. Bzw. nicht immer ein nützliches Tool. Inhalte müssen her! Ich würde mir wünschen, dass ich in solchen Momenten geschickter kommunizieren und die Leute gezielter abholen könnte. Und das ich aufgrund einer solchen Begegnung nicht jedes Mal meine ganze Berufswahl in Frage stelle. Das ist auf die Dauer ziemlich anstrengend. Zudem sollten Aussagen von Patienten nicht meinen Magen verknoten – eine Reaktion die wohl auch deutlich macht, dass ich mich in der Situation nicht wohl fühle oder nicht in der Lage bin, sie ohne weiteres zu handeln. Auf das zweitägige Seminar mit Prof. Dr. Thorsten Weidig vom 22. bis 23. März in Zürich freue ich mich nun sehr. Ich bin gespannt, welche Inputs er mir im Bereich Kommunikation und Motivation bei der Behandlung meiner Patienten und Athleten mitgibt. Der konstruktive Umgang mit verbalen oder non-verbalen kommunizierten Erwartungen und Annahmen ist mir wichtig. Und ich würde gern laut denken! Dafür sollten meine Gedanken aber bitteschön etwas eloquenter sein. Wenn auch Du Interesse hast, deine Fähigkeiten im Bereich der patientenzentrierten Kommunikation zu verbessern – es sind noch ein paar wenige Early Bird-Plätze frei! Mehr Infos zum Seminar und Tickets gibt’s hier.  Pain sells 😉 Vierundachtzig Teilnehmer im Technopark, zwei nervöse Organisatoren und ein Dozent in Höchstform – was für ein toller Event mit Lorimer Moseley! Spezialisten aus der Physio- und Ergotherapie, Osteopathie, Bewegungswissenschaft, Medizin und sogar der Rettungssanität – das Feld an Interessenten war breit gefächert. Schön war zu hören, dass sich der Tag für die grosse Mehrheit – trotz vorweihnachtlichem Trubel – gelohnt und praxisrelevantes Wissen mitgenommen werden konnte. Lorimer konnte mit seiner lebendigen Präsentation das interdisziplinäre Publikum in seinen Bann ziehen und den Schwerpunkten der unterschiedlichen Fachgebiete gerecht werden. Seine locker-unterhaltsame, gleichzeitig ausgesprochen professionelle und kompetente Art hat die Zeit sehr schnell verfliegen lassen. Weihnachtswunsch erfüllt science2practice wünscht sich, Wissenschaft greif- und nachvollziehbar zu gestalten. Diesen Wunsch hat Lorimer mit seinem ersten Auftritt in der Schweiz definitiv erfüllt. Das Thema Schmerz ist riesig, extrem umfassend und wäre auch in einem Monat noch nicht ausreichend besprochen. Lorimer hat es geschafft, für einige einen neuen Blickwinkel auf Schmerzverarbeitung und -patienten zu öffnen. Für andere konnte bestehendes Wissen weiter vertieft bzw. auf den neuesten Stand gebracht werden. Moseley in action Manch einer mag sich gefragt haben, wie diese Erkenntnisse nach den Feiertagen am Patienten umgesetzt werden können. – Genau so, wie Lorimer es uns aufgezeigt hat: Man beginnt damit, zunächst selber sicherer im Umgang mit Schmerzen und dem zugrundeliegende Wissen zur Schmerzphysiologie, von DIM‘s und SIM‘s und den vielen weiteren kleinen Bausteinen zu werden. Das Beispiel des Eisberges verdeutlicht den Therapieansatz sehr gut. Die zehn Prozent die man davon sieht, kann man an den Patienten weitergeben. Aber es braucht die unsichtbaren 90% des Eisberges an unter Wasser liegendem Wissen, um die sichtbaren 10% verständlich und nachvollziehbar erklären zu können. Das setzt voraus, dass man sich u.a. in den Bereichen DIM‘s und SIM‘s, Graded Exposure, Graded Motor Imagery und Motivational Interviewing einliest, fortbildet und austauscht. Welcome to 2019 Wir haben auf jeden Fall vorgesorgt und diesbezüglich mit Thorsten Weidig, Lars Avemarie, Thomas Nickl und Frans van den Berg auch im 2019 die passenden Gäste im Angebot. Aus Fehlern lernen, im neuen Jahr besser werden – das haben wir uns fest vorgenommen, denn unsere Fortbildungen sollen für Euch ein rundum zufrieden stellendes Erlebnis darstellen und wir sind bemüht, dafür die besten Voraussetzungen zu schaffen. Über Euer Feedback sind wir immer dankbar: info@science2practice.ch Weiterführende Literatur- und Videoempfehlungen zum Thema Schmerz: Bücher
YouTube
Auf diesem Wege noch einmal vielen herzlichen Dank für Eure Teilnahme! Wir hoffen sehr, dass wir Euch bald wieder bei einer Veranstaltung begrüssen dürfen. David & Pascale Pascale Gränicher  Eine unerwartete Verletzung kann einen ganz schön aus der Bahn werfen. Schock, Wut, Angst, Traurigkeit, Frustration, Hilflosigkeit. Gefühlsregungen, die ein Unfall oder eine Erkrankung auslösen kann. Die alltägliche Routine wird gestört, man ist plötzlich auf andere Personen angewiesen, braucht Unterstützung bei alltäglichen Verrichtungen. Dass das aufs Gemüt schlägt ist nachvollziehbar. Profis auf der Bank Für Sportler kann eine physische Beeinträchtigung, selbst wenn sie zeitlich befristet ist, neben den oben genannten emotionalen Reaktionen auch Existenz- oder Versagensängste auslösen. Einige Studienergebnisse deuten darauf hin, dass Athleten diese Reaktionen während der Reha im Vergleich zu sportlich inaktiven Menschen stärker erleben und häufiger an Stimmungsschwankungen oder Bestürzung leiden. Die Mannschaft wird im Stich gelassen, der Sponsor verlängert den Vertrag nicht, der Trainer ist enttäuscht und die Fans fordern Ersatz. Das Kapital eines Athleten oder einer Athletin ist eigene Körper. Ist dieser nicht voll einsatzfähig, sinkt das Selbstwertgefühl. Das wiederum beeinträchtigt u.a. über die Ausschüttung von Stresshormonen den Fortschritt der Wundheilung und das emotionale Krankheitserleben. Die psychosoziale Reaktion auf eine Verletzung beeinflusst somit auch wie das Gewebe heilt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wieder an alte Leistungen anknüpfen zu können. Mental Readiness In den letzten Jahren hat sich weiter herauskristallisiert, dass die psychologische Verfassung z.B. nach VKB-Rekonstruktion ein potentiell modifizierbarer Faktor für ein erfolgreiches sportliches Comeback darstellt. Die sogenannte „Mental Readiness“ oder mentale Bereitschaft, wird entscheidend durch Emotionen, Zuversicht in die verletzte Struktur und Vertrauen ins Wiedererlangen der eigenen Leistungsfähigkeit geprägt. Im Verlauf der Rehabilitation wandeln sich anfänglich negative Emotionen zu einer zuversichtlicheren Haltung. Der Zeitpunkt dieser Wendung scheint an den subjektiv erlebten Fortschritt geknüpft zu sein. Das heisst, hat der Athlet das Gefühl es geht vorwärts, ist er auch motivierter. Dabei lohnt es sich, neben dem objektiven Verlauf auch zu erfassen, wie ready sich der Patient fühlt. Die psychologische Bereitschaft für einen Wiedereinstieg in den Sport ist genauso wichtig wie die physischen Parameter. Heutzutage werden professionelle Sportler meist gut aufgefangen und erhalten rasch kompetente Betreuung auf physischer und mentaler Ebene. Neben Familie, Freunden oder Teamkollegen ist oft auch ein Psychologe zur Stelle. Ärzte, Trainer und Physiotherapeuten klären auf, kümmern sich um den Bewegungsapparat und ermöglichen im besten Fall einen individualisierte komplikationsfreie Rückkehr in den Profisport. „Es geht schon.“ Aber wer zieht den Otto Normalverbraucher nach einer Humerusfraktur oder Achillessehnenruptur aus dem Motivationstief? Wird er über die (temporären) Einschränkungen im Alltag nach einer allfälligen OP aufgeklärt und auf einen zähen Verlauf vorbereitet? Weiss er, dass es normal sein kann, nach einem operativen Eingriff mit Schmerzen und schlaflosen Nächten zu kämpfen? Es hiess doch, alles sei dann wieder gut. Das Knie lässt sich aber kaum beugen und ist auch nach einer Woche noch geschwollen. Ist das normal? Er bezweifelt, dass ein hink freies Gehen, geschweige denn Rennen, je wieder möglich sein wird. Dass er seine Ängste in persönlichen Gesprächen mit Mental-Trainern oder Psychologen mitteilen kann, ist eher unwahrscheinlich. Auch “normale” Menschen oder Hobbysportler können nach einer Verletzung in ein Tief fallen und erleben Einbussen ihres Selbstwertgefühls. Dieser Umstand wird aber weniger beachtet. Denn sie sind in den meisten Fällen ja nicht ausschliesslich auf ihre physische Leistungsfähigkeit angewiesen. Aber auch? Der Schreiner, der wegen einer Ellbogenfraktur acht Wochen ausfällt kämpft wahrscheinlich genauso mit seinem Selbstwertgefühl wie der Handballspieler aus dem National-Team. Oder der Kunstschlosser mit OSG-Distorsion der seinen Auftrag nicht rechtzeitig fertig schafft, wird ebenso mit schlaflosen Nächten und Verlustängsten zu kämpfen haben wie die Ballerina drei Monate vor der grossen Premiere. Wie steht es mit der mentalen Bereitschaft für den Wiedereinstieg in den Job? Mit den inneren Barrieren umzugehen und sie Stück für Stück abzubauen ist ebenfalls Teil einer umfassenden Rehabilitation – auch bei Otto Normalverbrauchern. Warnzeichen Wann macht es Sinn einen Psychologen beizuziehen? Einige Indikatoren die anzeigen, dass ein Patient oder Athlet nicht klarkommt mit seiner Situation:
Die Motivation für eine anstrengende, nervenaufreibende Rehabilitation zu halten ist kein Kinderspiel. Umso mehr sind Betroffene auf die Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld, aber auch aus medizintherapeutischen Reihen angewiesen. Was Ihr als Fachpersonen beitragen könnt
Tipps für Patienten und Sportler nach einer Verletzung
Vom 22.-23.03.2019 habt Ihr die Möglichkeit praxisnahe Methoden und Techniken der von einem über die Landesgrenzen hinaus anerkannten Experten zu erlernen. Der Sportpsychologe Prof. Dr. Thorsten Weidig wird Euch die motivierende Gesprächsführung näher bringen und Werkzeuge für die Arbeit mit verletzten Sportlern bereitstellen. Tickets und weitere Infos findet ihr hier. Literatur Brewer, B.W., Linder, D.E., & Phelps, C.M. (1995). Situational correlates of emotional adjustment to athletic injury. Clin J Sport Med; 5: 241–245. Clement, D., Arvinen-Barrow, M. & Fetty, T. (2015). Psychosocial Responses During Different Phases of Sport-Injury Rehabilitation: A Qualitative Study. J Athl Tr; 50(1): 95-104. Johnston, L.H. & Carroll, D. (2000). The psychological impact of injury: effects of prior sport and exercise involvement. Br J Sports Med; 34: 436-439. McDonald, S.A. & Hardx, C.J. (1990). Affective response patterns of the injured athlete: an exploratory analysis. Sport Psych; 4:261-274. Newcomer Appaneal, R., Rockhill Levine, B., Perna, F.M. & Roh, J.L. (2009). Measuring Postinjury Depression Among Male and Female Competitive Athletes. J Sport & Psych; 31: 60-76. Webster, K.E. & Feller, J.A. (2018). Development and Validation of a Short Version of the Anterior Cruciate Ligament Return to Sport After Injury (ACL-RSI) Scale. Orth J Sports Med; 6(4): DOI: 10.1177/2325967118763763 |
AutorSchreiben Sie etwas über sich. Es muss nichts ausgefallenes sein, nur ein kleiner Überblick. Archiv
September 2023
Kategorien |
||||||||||||
|
science2practice GmbH EVIDENZBASIERTE FORTBILDUNGEN Asylstrasse 32 CH-8708 Männedorf Email: info@science2practice.ch Telefon: +41 (0) 78 642 05 97 |
|